
Maximilian I. (1598, Wikipedia)
Teil IV
Unsere Geschichte der »Großen« erreicht nun die letzte Epoche, die
Neuzeit. Die meisten der Persönlichkeiten, die den Ehrentitel »der« oder
»die Große« in dieser Ära erhielten, sind allseits bekannt, und doch hält
die Geschichte noch Überraschungen bereit.
Das Ende des Mittelalters und den Beginn der
Neuzeit setzt man im Allgemeinen zwischen 1450 und 1500 an. Das war das
Zeitalter der Entdeckungen, von Humanismus, Renaissance und Reformation.
Die Welt befand sich im Umbruch. Zu ihrer Erforschung in allen Kontinenten
und damit der Begründung eines neuen Weltbildes trat das Aufkommen auch
eines neuen Menschenbildes in Europa. All dies hatte weitreichende Folgen
für die meisten Lebensbereiche, mit tiefen kulturellen, geistigen,
gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen. Auf der einen
Seite stand die Entwicklung von Nationalstaaten, die schon im 14. und 15.
Jahrhundert begonnen hatte, im Zuge derer die durch die Kirche bzw. das
Papsttum in gewisser Weise garantierte oder doch zumindest repräsentierte
mittelalterliche Einheit zu Gunsten eines europäischen Staatensystems
aufgehoben wurde. Auf der anderen Seite wirkte die Emanzipation des
Bürgertums gegenüber dem Adel mit seinem fortschreitenden
Privilegienverlust prägend, und diese Emanzipation hing wiederum zusammen
mit gesellschaftlichen und ökonomischen Wandlungen durch die Entwicklung
von Handwerk und Gewerbe. Denk- und Arbeitsstil änderten sich; der Weg zur
frühkapitalistischen Wirtschaft mit ihren rationelleren Praktiken und
Techniken gerade auch im Handel, beschleunigt durch die Verwendung der
arabischen Ziffern und der damit einhergehenden Mathematisierung u. a. der
Geldgeschäfte, wurde Schritt für Schritt geebnet. Der Absolutismus gehörte
ebenso zur Neuzeit wie die Epoche der Aufklärung, der Dreißigjährige Krieg
wie die Französische Revolution, die Romantik und das heraufziehende
Industriezeitalter, und auch wir im 20. und 21. Jahrhundert leben noch
immer in der »Neuzeit«. Dass auch sie ihre »Großen«aufweist, ist nicht
weiter verwunderlich.
1. Die Welt im Umbruch
Etwa zu der Zeit, da man heutzutage den Beginn der Neuzeit datiert,
übernahmen die Habsburger die Macht im Heiligen Römischen Reich, wenn man
hier überhaupt noch von Macht sprechen kann. Die Wahl Albrechts II. (geb.
1397; König 1438 (vorher schon König in Ungarn und Böhmen); gest. 1439)
leitete die fast 370 jährige Ära ein, in der Habsburger die römische bzw.
später römisch-deutsche Königs- und Kaiserkrone trugen. Nur zwischen 1742
und 1745 hatte ein Wittelsbacher die Würde inne: Karl VII. Albrecht (geb.
1697; König 1742 (vorher schon in Böhmen); gest. 1745). Sieht man davon
ab, regierten die Habsburger von 1438 bis 1806, dem Ende des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation, aber dann noch einmal von 1804 bis
1918 in Österreich im sogenannten »Heimlichen Heiligen Römischen Reich«.
Schon nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden »kaiserlich« und
»österreichisch« häufig als Synonym aufgefasst. Dieser unsägliche Krieg
(1618–48) hatte das Reich in viele Einzel-Fürstentümer zertrümmert und
damit die Reichsgewalt entscheidend geschwächt. Aber schon vorher hatte
das Ansehen der Könige und Kaiser stark gelitten. Dies hatte weniger mit
den Habsburgern zu tun, die genügend fähige Herrscher aufzuweisen hatten,
als mit der allgemeinen Entwicklung, die eben schon skizziert wurde: das
Erstarken der Fürstentümer und der Bürger, damit auch der Städte, die nun
reichsunmittelbar waren und von einer eigenen Landeshoheit für sich
ausgingen. Als weiterer bedeutender Faktor kamen die Spaltung des Reiches
durch die im Zuge der Reformation entstandenen konfessionellen
Ausrichtungen der Fürstentümer und die Religionskriege hinzu. In dieser
Zeit braute sich im Osten des Reiches eine Gefahr zusammen, die es über
Jahrhunderte in Atem hielt: die Ausdehnung des Osmanischen Reiches. Die
europäischen Staaten zu einer gemeinsamen Abwehr des Islam zu bewegen,
sollte sich als unmöglich erweisen.
Osmanische Eroberer und abendländische Verteidiger: Mohammed,
Suleiman, Stefan und Radu die Großen
Nach dem Sieg des Seldschukensultans Alp Arslan (1029–1072) über das
Byzantinische Reich 1071 bildete sich um Konya und Kayseri ein erstes
islamisches Sultanat auf türkischem Boden, die Keimzelle für das spätere
Osmanische Reich. Viele türkische Nomaden strömten nun nach Anatolien, und
schon im 12. Jahrhundert erreichte das Seldschukenreich seine erste Blüte,
die durch den Einfall der Mongolen ab 1243 ein Ende fand. Zahlreiche
Kleinfürstentümer bildeten sich nun, darunter ein Grenzstaat im
Nordwesten, in Bithynien; nach dem Sohn des Gründers, Osman I. Ghasi (geb.
1258?; Fürst seit etwa 1300; gest. 1324) wurden das sich hier entwickelnde
Reich und die Dynastie benannt. Hauptstadt des Osmanischen Reiches wurde
das 1361 eroberte Adrianopel, Edirne, und das Reich wurde bald so mächtig,
dass ihm das Byzantinische Reich tributpflichtig wurde. Schon bald dehnte
es sich nach Westen aus, was in Anbetracht seiner Lage nicht unlogisch
war. Schon zehn Jahre nach der Einnahme von Edirne nahm es Thrakien und
Makedonien in Besitz, und 1389, nach der berühmten Schlacht auf dem
Amselfeld, machte sich das Osmanische Reich Serbien tributpflichtig, 1395
die Walachei, und von 1393 bis 96 eroberte es Bulgarien und Thessalien.
Als nun abermals Mongolen und Angehörige anderer Völkerschaften in dass
Reich einfielen, diesmal unter dem türkisierten Mongolen Timur (Timur
Läng, Tamerlan; geb. 1336; reg. 1370–1405), und es 1402 beim heutigen
Ankara besiegten, wurde es nicht nachhaltig erschüttert. Der von dem
ungarischen Reichsverweser (1446–52) und bedeutendem Feldherrn Johann
Hunyadi (ca. 1408–1456) organisierte Widerstand brachte den Erfolg, dass
die Türken bis Sofia zurück weichen mussten; aber umgekehrt wurden
Hunyadis Truppen bei Warna 1444 und in einer neuerlichen Schlacht auf dem
Amselfeld 1448 geschlagen. Zwar verhinderte er, dass die Osmanen nach
Ungarn vordringen konnten, indem er eine türkische Armee, die Belgrad
belagerte, schlug, aber auf Dauer war gegen die Türken kein Kraut
gewachsen. Am 29. Mai 1453 eroberten sie Konstantinopel.
Der Sieger auf osmanischer Seite war Sultan
Mohammed II., der uns heutzutage als Mohammed der Eroberer bekannt ist,
wie er sich auch selbst sah. Nur wenige wissen, dass er in früheren
Quellen auch als Mohammed der Große betitelt ist, und so, mit beiden
Beinamen, erscheint er auch in der Enyclopedia Americana.
Mohammed II. Bujuk (der Große), el-Ghasi (Besieger der Ungläubigen) oder
el-Fatih (der Eroberer): so hat ihn die Geschichte überliefert. Geboren
1430 oder, nach neueren Angaben, am 30. März 1432 in Edirne, folgte er
seinem Vater mit rund zwanzig Jahren auf den Thron. Er war eine machtvolle
Persönlichkeit. Acht Monate lang sammelte er Mannschaften und Material
gegen Byzanz, die Hauptstadt eines sonst so gut wie nicht mehr
existierenden Reiches. Gegen rund 6 bis 7000 Söldner hatte er nach
früheren Angaben an die 140.000, nach heutigen Schätzungen etwa 80.000
Mann zu setzen, und die Gemetzel und Plünderungen nach der Eroberung waren
so brutal, blutig und grausam, wie sie sich nicht allzu oft in der
Geschichte ereignet haben – Historiker und nicht zuletzt die Muslime
würden an die Schändlichkeiten bei der Eroberung Jerusalems durch die
Kreuzfahrer 1099 erinnern. Erst, als man feststellte, dass Überlebende
durch Lösegeld mehr einbrachten als Tote, habe man den Massakern Einhalt
geboten. Mohammed soll nach einem Tag den Einhalt der Schlächtereien
befohlen haben, da sie selbst für seine Vorstellungen zu weit gingen.
Später hieß es sprichwörtlich von einem reichen Menschen, er sei
sicherlich bei der Eroberung Konstantinopels dabei gewesen. Mohammed
selbst behielt sich die öffentlichen Bauten als Beute vor. Als ein Soldat,
wohl im Übereifer, den Marmorboden der Hagia Sophia aufriss, schlug er mit
dem Szepter auf ihn ein. Die Throne Europas zeigten sich erschüttert, aber
kein christliches Heer war Byzanz zu Hilfe geeilt. Mohammed war erst zum
Angriff geschritten, als er sich sicher sein konnte, dass kein Entsatzheer
unterwegs war. Ebenso wenig war im Nachhinein an eine Einigkeit der
Fürsten im Kampf gegen die Türken zu denken. Vergeblich bemühte sich auch
Kaiser Friedrich III. (geb. 1415; König 1440; Kaiser 1452; gest. 1493)
1454 auf Reichstagen in Frankfurt, Regensburg und Wien um Unterstützung
und Einheit gegen das Osmanische Reich; er scheiterte wie alle anderen an
der Habsucht, dem Egoismus und der Zwietracht der europäischen Länder und
ihrer Regenten. Mit der Einnahme von Konstantinopel endete nach der
Klassifizierung der Weltgeschichte durch den deutschen Geschichtsprofessor
Christoph Cellarius (1638–1707) alias Christoph Keller das Mittelalter –
er nahm zum ersten Mal die bis heute erhaltene Dreiteilung in Antike,
Mittelalter und Neuzeit vor.
Mohammed machte Konstantinopel zu seiner
Hauptstadt; die Hagia Sophia, von der direkt nach der Einnahme
Konstantinopels ein Muezzin vom höchsten Turm aus zum Dankgebet an Allah
für den Sieg gerufen hatte, wurde aller christlichen Insignien entkleidet.
Der Sultan suchte nun, sein Reich nach außen und im Innern zu stärken. Er
fühlte sich berufen, zum Weltherrscher zu werden, und viele Zeitgenossen
haben das von ihm erwartet. Papst Pius II. (geb. 1405; Pontifikat
1458–1464), der auch meinte, in Mohammed den Weltherrscher gefunden zu
haben, schlug ihm brieflich vor, das Christentum anzunehmen, um so Herr
und Erlöser der Welt zu werden. Was Mohammed darüber dachte, ist
unbekannt. Aber auch unabhängig davon war es sein Ziel, Italien zu
erobern; er kam auch bis Italien, aber nicht bis Rom, wo man schon in
Angst und Schrecken verfallen war. Mohammed legte sich schon einmal den
Titel »Kaiser von Rom« zu, aber am Ende wurde nichts daraus. Immerhin
eroberte er 1456/58 Serbien, ein Jahr später das Kosovo, 1460/61 nahm er
die letzten byzantinischen Besitzungen in Griechenland sowie Trapezunt,
das heutige Trabzon, ein und 1463 noch Bosnien. Scutari entriss er den
Venezianern, Kaffa den Genuesen, 1475 unterstellte sich ihm die Krim, und
1480 eroberte er Otranto. Er starb am 3. Mai 1481 bei Gebze. Wer war nun
Mohammed der Große wirklich? Die Schilderungen über ihn reichen von
maßlosem Hass bis zu bedingungsloser Bewunderung, je nach Perspektive des
Beobachters. Die Grausamkeiten seines Heeres ließen ihn nicht
gleichgültig; den für die Scheußlichkeiten in Otranto verantwortlichen
Pascha ließ er hinrichten, aber umgekehrt brachte er seinen eigenen Bruder
um, um einen lästigen Konkurrenten los zu sein, was er sogar noch
gesetzlich legitimieren ließ, gemäß dem Satz im Koran: »Die Unordnung ist
schädlicher als Mord.« Er unterhielt Handelsbeziehungen zu etlichen
Mittelmeerstaaten, vor allem nach Italien. Auf der anderen Seite ließ er
zahlreiche Bauten errichten, so nach seinem Sieg die Moschee Eijubs, und
als sein größtes Bauwerk den Topkapi-Palast in Istanbul, von nun an für
Jahrhunderte Wohn- und Regierungssitz der Sultane und Verwaltungszentrum
des Reiches. 300 Moscheen, 50 islamische Hochschulen und 50 Bäder gingen
auf ihn zurück. Aber nicht nur Moscheen, Schulen oder Medresen
(Lehranstalten) verdankt ihm die Nachwelt, sondern auch Hospitäler,
Karawansereien, Bibliotheken, Brunnen, Imarete (Garküchen), das alte Serai
und sogar Irrenanstalten. Er setzte die Tradition der letzten Sultane fort
und widmete sich der Kunst, besonders der Poesie, schrieb selbst Gedichte
unter dem Namen Auni, der Hilfreiche, und zog eine Anzahl bedeutender
Dichter an seinen Hof, darunter sogar zwei Dichterinnen. Indische und
persische Gelehrte gingen bei ihm ein und aus. Seine Nachfolger traten in
seine Fußstapfen, erwiesen sich als grausame Eroberer und pflegten
gleichzeitig die Musen, so auch Suleiman der Große.
Suleiman II. ist uns eher als »der Prächtige«
geläufig. Er hatte den Beinamen »el-Kanuni«, was als der Große oder
Prächtige übersetzt wurde; die Türken nennen ihn den »Gesetzgeber«. Er
gilt als einer der größten Sultane des Osmanischen Reiches. Geboren wurde
er am 5. November 1494 in Trapezunt. Nach dem Tod seines Vater Selims I.,
der seit 1512 regiert hatte, kam er 1520 auf den Thron. Sein Erbe war ein
durch und durch gut organisiertes Reich, und ihm gelang es, dieses Reich
noch einmal zu erweitern; unter ihm erreichte es seine größte Ausdehnung.
Er eroberte 1522 die Stadt Belgrad, an der Mohammed der Große gescheitert
war; ein Jahr später fiel die Insel Rhodos, an der die Türken 1480
ebenfalls erfolglos geblieben waren, unter großem Blutvergießen (der Rest
des hier ansässigen Johanniterordens zog 1527 auf die Insel Malta, die
ihnen Kaiser Karl V. (geb. 1500; König 1520 (vorher schon in Spanien);
Kaiser 1530; Thronverzicht 1556; gest. 1559) schenkte, was der Papst 1530
bestätigte. Ungarn war dann 1526 an der Reihe, in der Schlacht von
Mohaksch wurde das christliche Heer unter Ludwig II., dem letzten
Jagiellonen, besiegt, er selbst getötet. Wiederum war die Zwietracht
zwischen den Fürsten nicht unschuldig an der Niederlage. Viele Feinde
Kaiser Karls standen auf der Seite Suleimans, Franz I. (geb. 1494; reg.
1515–1547), »der allerchristlichste König von Frankreich«, suchte ein
Bündnis mit ihm, die Herzöge von Bayern verhandelten mit ihm wegen ihrer
Ansprüche auf Böhmen, und Österreich, das heutige Slowenien und Friaul
lagen praktisch ungeschützt vor den türkischen Angreifern. In einem
deutschen Volkslied hieß es damals: »Der wütend Türk hat große Macht
neulich ins Ungarland gebracht […] Aus Ungarn ist er bald und schnell in
Österreich bei Tages Hell’, Bayern ist ihm gleich zur Hand, von dann er
kummt in andre Land, dem Rhein mag er bald kommen zu, damit haben wir kein
Zeit, kein Ruh’. Unser Unfleiß und Eigennutz, gegen den Nächsten stolzer
Trutz, Haß, Neid und Arglist Sinnen, die machen den Türken gewinnen.« Vor
allem letzteres!
Endlich, fast in letzter Minute, kam es zum
Frieden zwischen Kaiser und Papst, auch Franz I. lenkte ein. Und als dann
im September 1529 die osmanischen Truppen Wien belagerten – Suleiman hatte
geschworen, er werde nicht eher ruhen, als bis das Gebet des Propheten vom
Stephansdom gesprochen werde – zitterte das Abendland, doch musste
Suleiman im Oktober die Belagerung aufheben; Mangel an Nahrung und die
schlechten Witterungsbedingungen, zudem Unzufriedenheit in den eigenen
Reihen, zwangen ihn zur Umkehr. Suleimans Macht blieb ungebrochen. Zwar
nahm ihm 1535 Karl V. in einem vielfach verherrlichten Feldzug Tunis ab –
das Osmanische Reich beherrschte einen Großteil der Küste Nordafrikas, wo
seine Piraten ihre Stützpunkte hatten; durch seine Flotte war Suleiman
Herr im Mittelmeer und auch im Roten Meer – aber ein Jahr später schloss
er eine Allianz mit Frankreich gegen die Habsburger. Endlich, 1533, kam es
zu einem leidlichen Frieden mit dem Kaiser. Dadurch erhielt Suleiman den
Rücken frei für seine Eroberungen im Osten: In den Jahren 1534 bis 1538
eroberte er Bagdad und Aden, vorübergehend auch Täbris in Persien, und er
fügte die südliche und westliche Küste der Arabischen Halbinsel dem
Osmanischen Imperium hinzu. Sein Versuch, 1565 Malta zu erobern, schlug
indes fehl.
Wie Mohammed der Große hatte auch Suleiman der Große mehrere
Charakterseiten. Seine Reformen und Gesetzeswerke, die u. a. die
Landverteilung, die Verwaltung, die sich noch lange in der von ihm auf den
Weg gebrachten Form erhielt, oder die Organisation der Geistlichkeit
betrafen – er verbesserte auch die Lage der Christen in seinem Reich –
brachten ihm mit Recht großes Lob. Er förderte die Kunst und die
Architektur und vor allem die Literatur, schrieb auch selbst unter dem
Namen Muhibbi an die 3000 lyrische Gedichte. Mit seiner Unterstützung
schuf der berühmte, begnadete Architekt Sinan (ca. 1500–1588), der 1538
Baumeister für das gesamte Osmanische Reich wurde, mehr als 300 Bauwerke,
Mausoleen, Paläste, Medresen, Moscheen wie die prachtvolle
Suleiman-Moschee in Konstantinopel, wo Suleiman auch begraben ist, und die
Selim-Moschee für seinen Vater in Edirne. Andererseits ließ er seinen
Großwesir Ibrahim, der von 1523 bis 1536 die Verwaltung leitete und dem
die meisten von Suleimans Gesetzes- und Reformwerken zu verdanken sind,
ohne ersichtlichen Grund erdrosseln, und seinen ältesten Sohn und andere
Familienmitglieder ließ er ermorden. So bleibt ein Schatten auf diesem
außergewöhnlichen Herrscher lasten. Suleiman, der seine Heere persönlich
in die Schlacht zu führen pflegte, starb am 7. September 1566 bei der
Belagerung von Szigetvár bei Pécs auf einem seiner Feldzüge, diesmal im
Krieg mit Österreich. Er und sein Vorfahr Mohammed der Große bleiben in
der osmanischen, aber auch in der europäischen Geschichte unvergessen.
Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des
Osmanischen Reiches sind noch zwei »Große« zu nennen, die nun aber auf der
Gegenseite standen. Der eine ist der berühmte Stephan III. der Große,
Fürst von Moldau. Geboren wurde er 1433 in Borzeşti, wahrscheinlich als
unehelicher Sohn des dortigen Fürsten, aber von seinem Vater schon früh an
der Macht beteiligt und nach dessen gewaltsamem Tod 1451, Flucht und Exil
mit 24 Jahren Fürst. Die Woiwodschaften Walachei und Moldau sind uns
bereits begegnet, auch die Fürsten der Walachei Mirtschea und Basarab die
Großen. Sie wurden noch um einiges von Stephan dem Großen überragt. Das
Fürstentum Moldau war wie die Walachei im 15. Jahrhundert, wie bereits
erwähnt, in den Einflussbereich des Osmanischen Reiches gekommen, konnte
sich aber noch eine gewisse Unabhängigkeit erhalten, so lange es
Tributzahlungen leistete. Da Polen und Ungarn immer wieder Zugriff auf
Moldau nehmen wollten, erschien dessen Fürsten die Tributpflicht gegenüber
den Osmanen annehmbarer. Seine Hauptaufgabe sah Stephan darin, die
Unabhängigkeit seines Landes gegenüber allen Nachbarn zu sichern. Dazu
führte er auch diverse Kriege. 1467 besiegte er den bekannten ungarischen
König Matthias I. Corvinus (geb. 1443; reg. 1458–90), den Sohn von Johann
Hunyadi, welcher uns eben begegnet ist. Matthias kämpfte gegen die Türken
in Serbien und Bosnien (1479–83) und gewann im Krieg gegen Kaiser
Friedrich III. sogar Niederösterreich mit Wien (1485 – 90), nicht lange
vor dem Tag, da die Türken zum ersten Mal vor Wien erschienen. Als die
Ungarn in Moldau einmarschierten, schlug sie Stephan in der Schlacht bei
Baia vernichtend, Matthias entkam schwer verletzt; später normalisierte
sich das Verhältnis beider Länder. Kurz danach, 1469 oder 1470, errang
Stephan einen Sieg über die Krimtataren, die in sein Reich einfielen bzw.
dazu von anderen Fürsten verleitet wurden. Lange Jahre, von 1473 bis 1489,
führte er Krieg gegen das Osmanische Reich, also noch zu einer Zeit, da
Mohammed der Große in Konstantinopel regierte. Mehrere Siege erlangte er,
z. B. 1475, als er mit 40.000 Mann etwa 120.000 Türken bei Vaslui schlug –
selbst der türkische Chronist nannte es eine noch nie da gewesene
Niederlage der Osmanen. Wie zu erwarten, blieb der Versuch von Stephan, im
Anschluss an den Sieg (und auch noch später) die europäischen Mächte gegen
die Osmanen zu einen, ohne Erfolg. Im nächsten Jahr verlor Stephan zwar
eine Schlacht gegen die Türken, dies blieb jedoch ohne Folgen, aber am
Ende sah er sich in Anbetracht der Gleichgültigkeit der übrigen Mächte und
der Stärke des Osmanischen Reiches doch gezwungen, auf Tributzahlungen
einzugehen. 1481 siegte er über die Walachei, und von 1497 bis 99
schließlich kämpfte Stephan gegen Polen, und das durchaus erfolgreich. All
diese Kriege führten nicht zu einer Verarmung des Landes, sondern zu einem
Machtzuwachs – seine Bauernkrieger und Bojarenscharen verehrten ihn – und
sogar zu einem wirtschaftlich-kulturellen Aufschwung. An die 44 Kirchen
und Klöster, die »Moldauklöster«, sowie eine Reihe von Festungen, letztere
nach einem klug berechneten System, ließ Stephan errichten; einige gehören
heute zum Weltkulturerbe. Gotische Elemente vereinigten sich in den
Kirchen mit orientalischen und ergaben so eine den Verhältnissen des
Landes angepasste Architektur. Er gründete das Bistum Radautz und brachte
damit die Organisation der Kirche zum Erfolg. Durch die Unterstützung von
Mönchen, die sich der Kunst und Literatur widmeten, trug er zur
Entwicklung einer hohen Kultur in seinem Lande bei. Immerhin regierte er
fast ein halbes Jahrhundert. Stephan starb am 2. Juli 1504 in Suceava
(Sutschawa) und wurde im Kloster Putna in der heutigen Bukowina bestattet.
Er wird heutzutage in der Republik Moldau und auch in Rumänien als
Nationalheld verehrt. Zahlreiche Stätten erinnern an ihn. Wegen seiner
Kämpfe für die Unabhängigkeit wurde und wird er von den jeweiligen
politischen Machthabern immer wieder für die eigenen Zwecke ge- oder
missbraucht. Aber wenn diese Symbolgestalt den Rumänen bzw. den Bewohnern
von Moldawien zu einem Identitäts- oder Selbstwertgefühl verhilft, so ist
dies letztlich nicht zu beanstanden.
Stephan mischte sich in die Verhältnisse anderer
Länder durchaus ein. In der Walachei hatte es längere Zeit wirre
Verhältnisse gegeben. Schließlich bestieg ein früherer Mönch namens Wlad
den Fürstenstuhl, nachdem Stephan den unfähigen Machthaber, auch einen
Basarab, abgesetzt hatte. Wlad der Mönch regierte von 1482 bis 1495. Dann
folgte sein Sohn Radu, der bis 1508 an der Macht blieb. Er stiftete das
prachtvolle, glänzende Kloster Dealu, in dessen Inschriften und Schmuck
sich bereits die Kunst der Renaissance wiederfindet; damit übertraf er den
größten Klosterstifter in der Walachei vor ihm, nämlich Mirtschea den
Großen, dem die wunderschönen serbisch-byzantinischen Bauen des Oltlandes
zu verdanken waren, und einheimische wie griechische Kleriker nannten ihn
wegen seiner Freigebigkeit »den Großen«. Als Radu den Großen findet man
ihn noch heute in den Geschichtswerken.
Walachei, Moldau, Rumänien – ihre Geschichte
durch die Jahrhunderte war immer verbunden mit denen der großen Mächte in
ihrer Nachbarschaft, und das keineswegs zu ihrem Vorteil oder Segen. Das
Osmanische Reich, durch Suleiman den Großen, den Prächtigen, zum Höhepunkt
geführt – schon seit 1517 trug der Sultan auch den Kalifentitel und war
damit Schutzherr der heiligen Stätten des Islam in Mekka und Medina –
verlor ab der vernichtenden Niederlage seiner Flotte bei Lepanto 1571 an
Einfluss; der innere und äußere Verfall begann; der Niedergang führte zum
Ende des Osmanischen Reiches 1923. Danach wendete sich das Blatt zu einem
Neubeginn.
In ferne Zonen: Johann und Emanuel die Großen
Der Beginn der Neuzeit war – wir sagten es schon – mit der Aufnahme der
nun in großer Zahl stattfindenden Entdeckungsreisen verknüpft. Es waren
zunächst die Portugiesen, die an ferne Küsten vorstießen. Initiator war
vor allem der Infant Heinrich der Seefahrer (1394–1460), seit 1419
Gouverneur des Königreichs Algarve und 1420 Großmeister des
Christusordens, der um sich nicht nur erfahrene Kapitäne, sondern auch
Experten in Kartografie, Nautik und Kosmografie versammelte und eine Art
Seefahrtsschule gründete. Schon seit 1418 veranlasste er die Erkundung der
Westküste Afrikas – Madeira erreichten die Portugiesen 1420, sieben Jahre
später die Azoren; Heinrich legte, obwohl er nicht König war, den
Grundstock für die portugiesische See- und damit später auch Handels- und
Kolonialmacht. Die Eroberung Konstantinopels beschleunigte die
Entdeckungsfahrten, da die Türken den Landweg zu den großen Handelsplätzen
in Asien gesperrt hatten und nun die Suche eines Seewegs nach Indien im
Vordergrund stand. Schon 1446 kamen die Portugiesen an die Senegalmündung,
zehn Jahre später zu den Kapverdischen Inseln, 1484 bis zum Kongo, und
1487/88 segelte Bartholomeus Diaz (ca. 1450–1500), besser: kämpfte er sich
im Sturm um die Südspitze Afrikas, das Kap der Guten Hoffnung, das er noch
Kap der Stürme nannte.
Heinrich der Seefahrer war der Sohn von König Johann I., der den
Ehrentitel »der Große« erhielt. Geboren wurde dieser 1357 in Lissabon.
Sein Thron war nicht unumstritten. Kastilien erhob Anspruch darauf, aber
Johann heuerte 500 englische Bogenschützen an und schlug die Kastilier am
14. August 1385, ein Sieg, dessen noch heute an Portugals Nationalfeiertag
gedacht wird. Von daher rührt – zwischen England und Portugal – eines der
ältesten Bündnisse der europäischen Geschichte (Vertrag von Windsor 1386),
das noch heute besteht. Als Königreich existierte Portugal bereits seit
1139; seine große Zeit kam aber erst jetzt. Johann war selbst der Spross
einer unglücklichen Liebe, nämlich König Pedros I. des Strengen (geb.
1320; reg. 1357–1367) und seiner Geliebten Inés de Castro; diese hatte er
angeblich nach dem 1345 erfolgten Tod seiner ihm schon 1336 über
Vollmachtsvertretung angetrauten Ehefrau Konstanze, Tochter des Prinzen
von Kastilien, heimlich 1354 geheiratet, was allerdings unbewiesen blieb.
Er hatte sich unsterblich in sie verliebt, als Konstanze mit ihr als
Kammerzofe 1340 an den Hof kam – doch Pedros Vater, König Alfons IV. (geb.
1290; reg. 1325–1357), ließ sie aus dynastischen Gründen ermorden (1355);
da hatte allerdings Ines ihrem Liebhaber oder Gemahl, wie auch immer,
schon vier Kinder geboren. Als Pedro an die Macht kam, ließ er etliche der
Mörder umbringen; dann ließ er den Leichnam von Inés exhumieren und die
Tote mit den königlichen Insignien neben sich auf dem Thron krönen, bevor
er sie wieder bestatten ließ, womit für die portugiesische Literatur eines
ihrer bedeutendsten Themen geboren war. Johann hieß darum auch »der
Bastard«. Er begründete die Dynastie der Avis, die bis 1580 an der Macht
blieb. Johann selbst regierte 48 Jahre lang. Er reformierte und
verbesserte Recht, Rechtsprechung und Verwaltung; durch ihn – eine seiner
größten Leistungen – wurde Portugiesisch die offizielle Landessprache. In
Batalha ließ er zur Erinnerung an den Sieg über Kastilien eine
Dominikanerkirche erbauen, Santa Maria da Victoria, die vom Stil her an
Notre Dame in Paris oder auch – von der Größe her – an den Mailänder Dom
gemahnt. Johann der Große starb am 14. August 1433. Sein Sohn Heinrich der
Seefahrer hatte ihn 1415 dazu gebracht, Ceuta, die marokkanische Stadt,
die Gibraltar gegenüber liegt, und die dazu gehörige Region zu erobern;
damit hatte er die portugiesische Ausdehnung in Afrika eingeläutet.
Kurz nach Erreichen der Südspitze Afrikas, 1492,
landete Christoph Kolumbus (1451–1506), in Amerika, aber für die
Weltgeschichte vorrangiger war zunächst der Seeweg nach Indien, den
endlich 1497/98 Vasco da Gama (ca. 1469–1524) im Auftrag des
portugiesischen Königs Emanuels I. fand. Ganz Portugal hatte dem Ereignis
entgegengefiebert, und in Anbetracht der Schätze, die Kolumbus aus Amerika
mit brachte, hielt es der portugiesische Herrscher für an der Zeit, es den
Spaniern gleich zu tun.
Emanuel, portugiesisch Manuel, wurde am 31. Mai
1469 bei Lissabon geboren und kam 1495 auf den Thron. Als Emanuel der
Glückliche bzw. als Emanuel der Große ging er in die Geschichte ein. Wie
seine Vorgänger unterstützte er die Entdeckungsreisen nach Asien und
Amerika. Vor allem Vasco da Gama, Pedro A. Cabral (ca. 1468–1520 oder
1526), der 1500 die Ostküste Brasiliens erreichte und das Land für
Portugal in Besitz nahm, und Afonso de Albuquerque (1453 oder 1462–1515),
der die Tore zum indischen Handel Hormus, Goa und Malakka eroberte,
einheimische Fürsten zu Vasallen degradierte und von 1509 bis zu seinem
Tode Vizekönig von Indien war, wurden von ihm gefördert. Emanuels Ziel war
es vor allem, ein portugiesisches Handelsmonopol in den Ländern rund um
den Indischen Ozean zu schaffen, aber auch Amerika lag ihm am Herzen.
Damals wetteiferten die Spanier und Portugiesen als die führenden Nationen
um die Beherrschung der fernen Welten. In den Verträgen von Tordesillas
(1494) und Saragossa (1529) legten sie ihre Interessenssphären fest. Den
Vertrag von Tordesillas hatte noch Emanuels Vorgänger, sein Cousin Johann
II. (geb. 1455; reg. 1481–1495), geschlossen; er teilte die Welt in zwei
Sphären, wobei die weiter entfernt liegenden Regionen nach ihrer
Entdeckung Spanien zufallen sollten. Johann II. gilt manchen Historikern
als der bedeutendste portugiesische König, aber in Anbetracht der
Leistungen Emanuels kann man darüber geteilter Meinung sein … Die erste
Weltumseglung fand von 1519 bis 1522 unter dem portugiesischen Seefahrer
Ferdinand Magellan (Fernão de Magalhães; ca. 1480–1521) bzw. seinem
Nachfolger Juan S. Elcano (ca. 1468–1526) in spanischen Diensten statt.
Wurden Südamerika seit 1498 und Mittelamerika seit 1502 allmählich in
Besitz genommen, waren die nächsten Stationen im Osten Goa (1510), Malakka
(1511), die Molukken (1512), Kanton (1517), Neuguinea (1526) und
schließlich auch Japan (1542). Bis zu seinem Tode am 13. Dezember 1521 in
Lissabon betrieb Emanuel energisch für Portugal die Entdeckung und
Inbesitznahme ferner Gestade und Länder, doch er machte sich auch auf
anderen Gebieten einen Namen in der portugiesischen Geschichte. Seine
kluge Außenpolitik bewahrte das Land vor Kriegen, aber er verwies 1496 die
Juden und die nach der Eroberung Granadas 1492 als letztem Bollwerk der
Muslime in Spanien nach Portugal geflohenen Mauren aus dem Lande. In
seinem Regime nahm er ein wenig den Absolutismus vorweg – er
zentralisierte die Verwaltung und festigte die Macht der Krone gegenüber
dem Adel und den Städten, deren bisher genossene Freiheiten bedeutungslos
wurden, und setzte darin die Politik von Johann II. fort, ja verstärkte
sie sogar – in seiner Regierungszeit wurden die Stände nur dreimal
einberufen. Daraus ergaben sich konsequenterweise auch die
Vereinheitlichung des Steuer- und Zoll- sowie die Reformierung des
Finanzwesens. Ein neuer Rechtskodex, die »Ordenações Manuelinas«, wurde
unter seiner Regierung erlassen. Die Eroberungen und der beginnende
Überseehandel brachten Gold in die Staatskassen und Gewürze als
Wirtschaftsgut, mit denen sich viel Geld verdienen ließ, das den
Staatseinnahmen zu gute kam. Unter seiner länger als ein
Vierteljahrhundert dauernden Herrschaft blühte Portugal in Kunst, Kultur
und Wissenschaft auf, besonders in der Baukunst. Der nach dem König
benannte Emanuelstil entwickelte sich zu einer eigenen dekorativen Form
der spätgotischen Architektur, der verschiedene Elemente (Flamboyantstil,
Mudéjarstil, Platereskenstil) kunstvoll mit nautischen, maritimen und
exotischen Elementen verband, die ihren Ursprung in den überseeischen
Entdeckungsreisen und der damit verbundenen Entdeckerfreude hatten. Im
Turm von Lissabons Stadtteil Belém, heute ein Wahrzeichen Lissabons, und
im Hieronymitenkloster in Belém, beide heutzutage berühmte
Fremdenattraktionen und Weltkulturerbe der UNESCO, findet er sich
besonders gut dokumentiert. Insgesamt bescherte Emanuel Portugal ein
»Goldenes Zeitalter«, was auch in seinen Titeln »der Glückliche« bzw. »der
Große« seinen Ausdruck fand. Mit seiner weisen Heiratspolitik schuf er
verwandtschaftliche Beziehungen zum spanischen Königshaus – er selbst war
dreimal verheiratet, zunächst mit Isabella und danach mit ihrer Schwester
Maria, beides Töchter des bereits erwähnten, berühmten spanischen
Königspaares Isabella und Ferdinand, die die Weltmachtstellung Spaniens im
16. Jahrhundert begründeten, und zuletzt mit Leonora, der Schwester Kaiser
Karls V. Aus der Ehe mit Maria stammte sein Nachfolger Johann III., der
bis 1557 regierte und schon wieder einige Eroberungen aufgeben musste, was
mit zum Primat Spaniens in der Weltmachtstellung beitrug, und als die
Dynastie Avis 1580 ausstarb, führte dies zur Vereinigung Portugals und
Spaniens. In dieser Zeit hatten sich mittlerweile auch die anderen
Nationen an den großen Entdeckungen beteiligt, die Franzosen, Engländer
und Niederländer, um sich selbst einen Kuchen der großen, weiten Welt
abzuschneiden – das Zeitalter des Kolonialismus und Imperialismus zog
herauf…
Noch eigenständige Herrscher: Sonni Ali, Askia, Abbas und Akbar
die Großen
Im Lauf der Zeit unterwarfen die Europäer mehr oder weniger die ganze
bekannte Welt, aber bevor das geschah, brachten es noch einige
einheimische und selbstständige Fürsten zu »Großen« in fremden
Kontinenten.
Das schwarze Afrika, anders natürlich als Ägypten oder der Sudan,
erscheint uns, die wir davon nur wenige Kenntnisse haben, als
geschichtsloser Kontinent. In Wahrheit haben sich dort ebenso große Reiche
gebildet, sind gekommen und wieder vergangen, wie in Europa oder in Asien.
Man denke nur an das Imperium der Zulu unter dem »schwarzen Napoleon«
Tschaka (ca. 1789 (?)–1828), das dieser seit 1816 errichtete und das erst
1879 von den Engländern besiegt wurde – heutzutage gewinnt Tschaka als
Nationalheld einen gewissen Nachruhm in Südafrika. Ein anderes, früher
eher als geheimnisvoll angesehenes und legendenumwobenes Reich war
Monomotapa, das in Simbabwe im 15./16. Jahrhundert seine Blüte erlebte und
heute noch durch seine verlassenen Goldbergwerke und seine Ruinen bekannt
ist. Wenden wir uns nach Nordafrika, so finden wir beispielsweise im
westlichen Sudan (der Sudan erstreckt sich rein geografisch vom Roten Meer
bzw. dem Äthiopischen Hochland bis an den Atlantik, bis zum Senegalbecken
und wird im Norden durch die Sahara und im Süden durch die tropische
Regenwaldzone begrenzt, ist also nicht identisch mit dem heutigen Staat
dieses Namens) mehrere Reiche: Ghana, das schon ab etwa 300 n. Chr.
existiert haben soll und bis ins 14. Jahrhundert von Bedeutung war, Melle
oder Mali, das, am Ende des ersten Jahrtausends entstanden, im 14.
Jahrhundert, nun schon islamisch, seinen Höhepunkt erreichte, und Songhai
oder Sonrhai, das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zur großen
Macht aufstieg und auch unter dem Namen Gao bekannt wurde. Die Songhai
waren ein westafrikanisches Volk am mittleren Niger. Ihr Zentrum lag
innerhalb der großen Biegung des Stroms, südlich der sagenumwobenen
Handelsstadt Timbuktu. Mit Mande, Fulbe und anderen Völkern errichteten
sie, nachdem es hier schon im 7. Jahrhundert eine berberische Gründung
gegeben hatte, im 10. Jahrhundert das Reich Songhai mit der Hauptstadt
Gao. Etwa 1009/10 trat ihr König Kossoi, der von 1005 bis 1025 regierte,
zum Islam über, was für das Reich einen großen Umbruch bedeutete. Als nun
das Reich Mali immer mächtiger wurde, unterwarf es um 1325 auch Songhai,
doch machte sich letzteres um 1400 schon wieder selbstständig, und hier
begnügte man sich erst einmal mit der Unabhängigkeit. Nochmals verging
mehr als ein halbes Jahrhundert, dann trat Songhai aus seinem neutralen
Dasein heraus und einen Siegeszug über die Nachbarvölker an. Um 1465 kam
Ali aus der Dynastie der Sonni, aus berberischem Geschlecht, an die Macht
und suchte, durch weit reichende Eroberungskriege die Nachbarreiche zu
unterwerfen. Ali war zwar außerordentlich tatkräftig, aber galt auch,
vielleicht zu Recht, eher zu Unrecht, als sehr grausam. Er bekannte sich
nicht zum Islam, sondern war vom animistischen Glauben erfüllt und
praktizierte die Hohe Magie, und so hatte er auch keine religiösen
Skrupel, die muslimischen Reiche im Sudan zu unterwerfen. Vor allem auf
Kosten Malis breitete er sich aus. 1468 eroberte er eine der
Haupthandelsstädte des Mali-Reiches, nämlich das legendäre Timbuktu. Hier
hat man zwar antike ägyptische Bauten ausgegraben, aber die heutige Stadt
wurde 1087 als Tuareg-Lager gegründet und entwickelte sich zu einer
reichen und prachtvollen Handelsstadt. Auf seiner Reise 1352 bis 1354 quer
durch die Sahara zum Niger kam der arabische Weltreisende Ibn Battuta
(1304–1377) auch nach Timbuktu. Zu Sonni Alis Zeiten waren die Akil-Tuareg
die Herren der Stadt, die vorher die Mande vertrieben hatten, aber sich
vor allem durch Machtmissbrauch, Unterjochung der Einwohner bis hin zur
Vergewaltigung von Frauen und erdrückende Steuerlast hervortaten.
Schließlich bat der Gouverneur Omar Sonni Ali um Hilfe, was diesem wie
gerufen kam. Als sich dann ein schwarzes (!) Heer der Stadt näherte,
gerieten die Bewohner in Panik und flohen, einschließlich der Elite mit
samt dem Gouverneur. Sonni Ali hat dann mehrere angesehene
Persönlichkeiten, die mit den Tuareg paktiert hatten und so für ihn
Hochverräter darstellten, töten lassen, und das brachte ihm bei seinen
Zeitgenossen und Nachfahren den Ruf eines höchst grausamen und brutalen
Herrschers ein, der er aber so nicht war. Um 1473 eroberte er auch die
Stadt Dschenné nach mehrjähriger Belagerung. Schließlich fiel auch
Massina, und Ali dezimierte die dort ansässigen Fulbe vom Stamm der
Sangare so stark, dass es hieß, ihre Reste hätten im Schatten eines
einzigen Baumes Platz gefunden. Jedenfalls waren die Fulbe von allen
Ämtern in Verwaltung und Justiz ausgeschlossen. Das alte Reich Ghana
brachte er großteils in seinen Herrschaftsbereich. Aber Sonni Ali war
nicht nur ein Machtmensch, er förderte in seinem Reich die Gelehrten,
denen er wertvolle Güter schenkte, gemäß seiner Überzeugung: »Ohne die
Gelehrten gäbe es auf dieser Welt weder Anmut noch Freude«, ließ
offizielle Akten des Königreiches anlegen und häufte unermessliche Schätze
an. Vor allem gegen die Tuareg musste er immer wieder zu Felde ziehen. Auf
dem Rückweg von einer derartigen Operation ertrank er 1492. Ali erhielt
den Beinamen Dâli, der »Sehr-Erhabene«, aber in die Geschichte ging er als
Ali Ber, d. h. Ali der Große, oder auch Sonni Ali der Große ein.
Alis Sohn Sonni Bakary, dem er ein gut
verwaltetes und gefestigtes Reich hinterließ, blieb nur etwa ein Jahr an
der Macht, dann wurde er durch einen Unterbefehlshaber Alis gestürzt, den
Gouverneur von Hombori, Mohammed ben Abu Bakr, einen Angehörigen des
Tekrur-Stammes der Sylla, der nun nicht mehr berberisch-hellhäutig wie
Sonni Ali, sondern ein »echter Schwarzer« war. Dieser nahm als König den
Namen Askia an: »Das Wort Askia stammt aus dem Songhai a si kyi ya:
›Er ist es nicht! Er wird es nicht sein!‹ Ein Schrei der Herausforderung
und des Unwillens, den die Töchter des Sonni Ali bei der Ankündigung des
Staatsstreichs General Syllas ausstießen. Der übernahm diesen Ausruf als
dynastischen Titel« – so beschreibt es der Historiker Ki-Zerbo. Askia kam
mit Hilfe der Muslime im Reich an die Macht. Anders als Ali war er ein
Herrscher, der planmäßig und ordnend vorging und dessen Frömmigkeit in
puritanische Sittenstrenge mündete. Traf z. B. seine Geheimpolizei einen
Mann an, der nachts mit einer Frau plauderte, wurde er sofort ins
Gefängnis gebracht. Nach außen führte Askia zur Vergrößerung seines
Reiches weiterhin Eroberungszüge; dazu gründete er im Gegensatz zu Sonni
Ali, der seine Streitkräfte immer wieder neu ausgehoben hatte, ein
stehendes Heer; nach innen förderte er Frieden und Moral. Eine glanzvolle
Wallfahrt nach Mekka 1496 brachte ihm viel Ansehen in der islamischen
Welt. Tausend Infanteristen und fünfhundert Reiter begleiteten ihn; dazu
nahm er 300.000 Goldstücke mit, von denen er ein Drittel als Almosen
verteilen ließ. Ein für ihn und sein Land herausragendes Ergebnis bestand
in der Verleihung der Kalifenwürde an ihn. Nach seiner Rückkehr nahm er
seine Kriegszüge wieder auf, erst gegen das islamfeindliche Reich Mossi,
dessen Grenzgebiete er verheerte, dann gegen Mali, dessen alte Hauptstadt
er zerstörte und das er tributpflichtig machte (1501). In weiteren
Feldzügen dehnte er das Reich weit nach Westen und Osten aus, wo er eine
Stadt nach der anderen in den Haussa-Staaten eroberte. Auch gegen die
Tuareg führte er immer wieder Krieg. Im Osten reichte das Reich nun bis an
den Tschadsee, im Westen bis an den Senegal, im Süden bis an den
Tropischen Regenwald und im Norden bis zu den Salzminen von Teghazza. Auch
Askia gewann sich den Titel »der Große«, wie er in den Enzyklopädien
genannt wird. Sein Ende war allerdings unrühmlich. In der Familie brach
Streit aus, und sein ältester Sohn Mussa zwang ihn 1528 abzudanken.
Allerdings wurde letzterer bald ermordet, und auch die nachfolgenden
Herrscher erreichten nicht mehr die Größe der Gründer. Das Reich, das
durch das Militär zusammen gehalten wurde, wurde gut verwaltet, umsichtig
dezentralisiert, was aber eine gewisse Starrheit nicht ausschloss, und die
örtlichen Machthaber hingen in ihrer Stellung ganz von der Laune des Askia
ab. Wirtschaftlich beruhte das Reich auf Hirse- und Reisanbau sowie der
Viehhaltung. Von großer Bedeutung war der Salzhandel, und das Salz wurde
gegen das Gold, das weiter im Süden von den dortigen Völkern gewonnen
wurde, getauscht. So konnte Timbuktu als Hauptstadt des Reiches zu seinen
glanzvollen Palästen und Moscheen kommen. Der maurische Reisende Leo
Africanus (ca. 1494–ca. 1552), der 1513 hier her kam, verbreitete ihren
Ruhm. Hier trafen sich die Karawanen aus aller Herren Länder, hier wurden
Sklaven umgeschlagen, der Handel mit Gold, Gummi und Straußenfedern
florierte. Und hier gab es eine islamische Hochschule und 180
Koranschulen; das islamische Hochschulwesen war weit entwickelt; der
Herrscher besoldete die Richter, Doktoren und Priester; die Literatur
wurde in hohen Ehren gehalten; islamische Gelehrte zogen von Stadt zu
Stadt, um Vorlesungen zu halten. Timbuktu hatte damals rund 100.000
Einwohner, mit Marktvorsteher, einem Polizeivorsteher und sogar einem
Kommissar für die Fremden. Dies entwickelte sich in einem »schwarzen«
Reich und ist uns Europäern bedauerlicherweise viel zu wenig bekannt
geworden.Von all dem ist auch nicht viel geblieben. 1590 stießen
marokkanische Truppen in Richtung Gao vor und besiegten die Übermacht des
damaligen Askia, Ishak II. (gest. 1592) dank ihrer Gewehre. Timbuktu wurde
erobert, das Reich zerstört. Vor der Entstehung der islamischen Staaten im
19. Jahrhundert und der französischen Kolonisation war Songhai das letzte
große Reich im mittleren Sudan. Als europäische Forscher, angelockt von
den sagenhaften Berichten über Timbuktu, hierher kamen – als erster der
Schotte Alexander Laing 1826, der das Abenteuer nicht überlebte, dann der
Franzose René Caillié (1799–1838) 1828 und der Hamburger Heinrich Barth
(1821–1865) 1852 – waren sie enttäuscht; der Ruhm war verblasst; Caillé
fand nur eine »Ansammlung von schäbigen Lehmhäusern in einer unermeßlichen
Ebene von ungewöhnlicher Trockenheit«. Zu Barths Zeit hatte sich der
Wohlstand wieder etwas verbessert, aber auch heute ist die Stadt in keiner
Weise vergleichbar mit ihrer Blütezeit vor 500 Jahren. 1893 nahmen
französische Truppen Timbuktu in Besitz, sie wurde dem französischen Sudan
angegliedert und, als aus diesem Teil des Landes 1960 die unabhängige
Republik Mali entstand, Regions-Hauptstadt dieses Staates. Damals hatte
sie 7000 Einwohner, heute etwa 30.000. Der Salzhandel ist noch immer
bedeutend, und die historische Altstadt wurde von der UNESCO zum
Weltkulturerbe erhoben, eine späte Reminiszenz an Sonni Ali und Askia die
Großen. Wenn man dann mit ansehen muss, wie Islamisten viele Heiligtümer
in Timbuktu zerstören, so Ende des Jahres 2012 geschehen, kann man darüber
nur, wie die damalige UNESCO-Direktorin Irina Bokova es ausdrückte,
schockiert sein.
Wenden wir uns nun nach Asien, so stoßen wir in Persien auf einen weiteren
»Großen« der Geschichte. Die »Großen« dieses Reiches aus der Antike, Kyros
und Dareios, haben wir ausführlich gewürdigt. Nach der Eroberung durch
Alexander den Großen herrschten in Persien bis 240 v. Chr. die Seleukiden,
dann die Parther, die das sogenannte zweite iranische Reich gründeten. 224
n. Chr. folgte das dritte iranische Reich unter den Sassaniden, das sich
erfolgreich gegen die Römer und danach gegen Inder, Hunnen und Türken zur
Wehr setzte und seinen Bestand bis 642 sicherte. Doch nun eroberten die
Araber Persien und islamisierten es. Viele Dynastien lösten einander in
der Folgezeit ab; zeitweise herrschten hier die Seldschuken, die Mongolen,
später dann Timur. Erst Ismail I., der 1524 starb, gelang es endlich nach
jahrhundertelangen Wirren, eine starke Dynastie, die der Safawiden, zu
begründen und in Persien einen einheitlichen Staat zu schaffen, dem er
auch Armenien und Aserbaidschan angliederte. Ismail I. war es, der in
seinem Land den Glauben der Zwölferschiiten einführte. Nun war Persien
reif für eine neue Blütezeit. Sie kam unter Schah Abbas I. dem Großen.
Geboren wurde dieser als Sohn von Schah Mohammed Khudabanda am 27. Januar
1571 und schon mit zehn Jahren nominell Gouverneur von Khorasan. Zum Schah
wurde er proklamiert, als sein Vater 1587 abgesetzt wurde, und seine erste
Tat war es, die Staatszügel anzuziehen. Zu Beginn seiner Regierung sah
sich Persien im Osten von den Usbeken bedroht, im Westen von den Osmanen.
Letztere erschienen Abbas als die größere Gefahr; daher schloss er mit
ihnen 1590 einen Vertrag, in dem er ihre bisherigen Eroberungen
anerkannte. Auf diese Weise an der einen Front Ruhe geschaffen, wandte er
sich gegen die Usbeken, die er 1598 bei Herat in Afghanistan überraschte
und vernichtend schlug. In der Folgezeit eroberte er auch Gilan,
Masenderan und fast ganz Afghanistan. Abbas gründete den Kern eines
nationalen Heeres, indem er einen besonderen Truppenteil, die Tüsenkdschi
(Flintenträger), bildete, darin dem Vorbild des Janitscharenkorps der
Osmanen folgend. Für diese Truppen warb er teilweise georgische und
armenische Christen an. Außerdem stellte er eine ihm treu ergebene
Leibwache auf, die Scha-sewen, »die den König lieben«, um eine Gegenmacht
zu der bisherigen Prätorianerkohorte der Safewiden, den Kisil Basch, zu
schaffen.
Nach 15 Jahren Vorbereitungszeit wandte sich
Abbas dann 1602 gegen die Türken, um die verlorenen Gebiete zurück zu
gewinnen. In Basra schlug er mit 60.000 Mann eine zweifache Übermacht.
1618 besiegte er die vereinigten türkischen und tatarischen Truppen bei
Sofian nahe Täbris so vollständig, dass er die Osmanen zu einem
Friedensvertrag zwingen konnte, in dem er alle früher an sie verlorenen
Gebiete zurück erhielt. Dazu gehörte z. B. Georgien. Aber das reichte ihm
noch nicht. Von den Portugiesen eroberte er 1622 die Insel Hormuz im
Persischen Golf, übrigens mit Hilfe einer englischen Flotte (interessant
in Anbetracht des portugiesisch-englischen Bündnisses aus den Zeiten
Johanns des Großen) – diesen Hafen ersetzte er durch den Festlandshafen
Bender Abbas. Ein Jahr später brach er den Frieden mit den Türken und
entriss ihnen sowohl Bagdad als auch Kerbela, Nedschef, Mossul und
Diyarbakir in Südost-Anatolien am oberen Tigris im heutigen Irak. Nun
erstreckte sich sein Reich vom Tigris bis zum Indus. Aber nicht nur durch
kriegerische Unternehmungen begründete Abbas seinen Ruf. Als er den Thron
übernahm, wurde Persien von Bürgerkriegen heimgesucht, allenthalben
herrschte Unruhe bis hin zur Anarchie. Abbas aber brachte dem Land Frieden
und Sicherheit. Dazu gehörte, dass er entsprechende Gesetze erließ und die
Infrastruktur in Persien sichtlich verbesserte. Er ließ Straßen bauen, mit
Brücken und Wegstationen, Karawansereien für die Handelskarawanen, und er
suchte auch sein Volk zu einen, indem er für die Verbreitung des Islam
warb; er selbst unternahm eine 800 Meilen lange Pilgerreise nach Meschhed
zu Fuß. Auf der anderen Seite erwies er sich als tolerant gegenüber nicht
islamischen Religionen wie dem Christentum und aufgeschlossen, was Ideen
aus dem Ausland betraf. Europäische Reisende waren an seinem Hof
willkommen, die er sogar für diplomatische Missionen an die europäischen
Höfe zu gewinnen suchte, um einen Bund gegen das Osmanische Reich zustande
zu bringen, was natürlich auch ihm nicht gelang. Seine Hauptstadt verlegte
er 1598 von Kaswin nach Isfahan und machte die Stadt zu einem blühenden
Kultur- und Wirtschaftszentrum, das in aller Welt Anerkennung fand. Hier
ließ er glanzvolle Bauten errichten, so die große Moschee, den Palast
Tschebel Sutun (»vierzig Säulen«) und die Brücke über den Senderud. In der
Nähe siedelte er Armenier an, womit er den Handel beflügelte. Die
indischen Erzeugnisse nahmen ihren Weg von Bender Abbass über Isfahan und
Täbris ans Schwarze Meer, was für Isfahan eine Quelle wachsenden und
großen Reichtums bedeutete. Auch an den heiligen schiitischen Stätten von
Nedschef und Kerbela förderte er die persische Baukunst, die, wie es ein
Historiker ausdrückte, »an reichem Buntschmuck der Säulenhallen und
Nischen durch Spiegeltäfelchen und Schnitzereien, an schimmernden
goldfarbenen und blauen Glasuren zum Schmuck der Wände Gefallen fand.«
Nicht von ungefähr erhielt Abbas den Titel »der Große«, und die Encyclopedia
Americana urteilt über ihn, er sei in Verwaltungsangelegenheiten
ein Genius gewesen, sowie ein überragender militärischer Stratege, der
seinem Land so viel mehr an Gebieten, Macht und Reichtum gebracht habe,
wie es nach ihm nie wieder geschah. Abbas der Große starb am 21. Januar
1629 in der Provinz Masenderan. Erst lange nach seinem Tod, 1722, wurden
die Safawiden gestürzt, von Afghanen; Persien verfiel in eine neue Epoche
der Unsicherheit und der politischen Wirren, und erst 1794 kam es zu einer
erneuten Einigung des Landes.
Ein Zeitgenosse von Abbas dem Großen machte in Indien von sich reden und
ist ihm als ebenbürtig an die Seite zu stellen: Akbar, was arabisch »der
Große« bedeutet, der eigentlich Djala ad-Din Mohammed hieß und 1556 zum
Großmogul von Indien aufstieg.
Indiens Geschichte, nicht weniger blutig und
grausam als die anderer Kontinente und Länder, reicht in graue Vorzeit
zurück. Die dort entstandene Indus- oder Harappakultur war eine Hochkultur
vom 4. Jahrtausend bis zur Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr., vor allem im
Industal, im Pandschab und bis nach Afghanistan angesiedelt. Etwa zu der
Zeit, als ihre Blüte zu Ende ging, wanderten die Arier, die sich selbst
als Aryer, »Edle«, bezeichneten, mit Pferden und Streitwägen durch das
Pandschab nach Indien ein und eroberten zunächst Nordindien, bis sie
zwischen 900 und 600 v. Chr. auch die Ganges-Ebene erreichten. Lange
dauerte es, bis sie sesshaft wurden und Ackerbau betrieben. Ihre
religiösen Vorstellungen waren die der Veden, daher nennt man diese Epoche
der indischen Geschichte auch das vedische Zeitalter. Um 1000 v. Chr. wird
zum ersten Mal das Kastenwesen erwähnt. Später kamen Buddhismus,
Dschainismus und andere Religionen zum ursprünglichen »Hinduismus« dazu.
Schon um 500 v. Chr. entstanden die ersten großen Reiche auf indischem
Boden. Beinahe ganz Indien und einen Teil von Afghanistan umfasste bereits
das Maurya-Reich, das seine größte Machtentfaltung unter König Aschoka
(gest. 232 v. Chr.) erreichte, der seit 273 oder 269/268 v. Chr. regierte.
Nach einem blutigen Beginn seiner Herrschaft wurde er zum Friedensfürsten,
dem ersten bedeutenden gewaltfreien Regenten der Geschichte, dem es ein
großes Anliegen war, sein Volk moralisch empor zu heben und darüber hinaus
den Buddhismus zu verbreiten. Warum ihm die Geschichte nicht den Titel
»der Große« zuerkannt hat, bleibt ihr Geheimnis. Auch das Maurya-Reich
hielt sich nicht, ebenso wenig wie das Großreich der Kushana, das um 50 n.
Chr. entstand, von Zentralasien bis Benares reichte und im 3. oder 4.
Jahrhundert endete, oder das Gupta-Reich mit seiner Hochblüte der
Sanskrit-Literatur, das um 350 n. Chr. ganz Nordindien umfasste – es erlag
um 500 den einrückenden Hunnen. Danach bildeten sich viele
Teilfürstentümer, die sich gegenseitig bekämpften; zwischenzeitlich
entwickelten sich auch wieder einmal größere Reiche in Nordindien wie das
Gurjara-Pratihara-Reich, das dem sich ausbreitenden Islam lange Widerstand
entgegensetzte, bis es um 1000 unterging; aber erst unter dem Islam kam es
wieder zur Ausbildung von bedeutenderen Einheiten. Nicht vor 1192 gelang
es jedoch trotz bereits früher erfolgter arabischer Vorstöße Mohammed von
Ghor (1173 – 1206), Indien dauerhaft zu besetzen. In Delhi wurde ein
Statthalter eingesetzt, der dann 1206 ein Sultanat begründete. Dieses
hielt sich bis zum Eindringen Timurs, der 1398 Delhi plündern ließ. Es
musste aber noch einmal ein halbes Jahrhundert vergehen, bis es Lodi (1451
– 1526) vermochte, von Delhi aus wieder eine feste Herrschaft in
Nordindien zu gründen. In der Schlacht von Panipat 1526 gelang es dem
Timuriden Babur (1483–1530), den Sultan zu besiegen; damit wurde er zum
Gründer eines neuen Reiches, des Mogul-Reiches. Dieses schloss er
allerdings nur lose zusammen, so dass es sein Sohn Humayun (1508–1556)
abermals hätte erobern müssen, was ihm aber nicht gelang. Nun schlug die
Stunde von Akbar.
Als Akbar im Oktober oder November 1542 in
Umarkot in Sind/Indien geboren wurde, befand sich sein Vater, ein relativ
schwacher Herrscher, gerade auf der Flucht vor dem afghanischen Heer unter
Scher Schah, der ihn besiegt hatte. Er war gerade 14, als er nach dem Tode
seines Vaters 1556 auf den Thron berufen wurde. Das geschah etwa ein Jahr,
nachdem Humayun mit Hilfe seines Schutzherrn, des Schahs von Persien, nach
Indien zurückgekehrt war und wieder von einem kleinen Teil seines
ursprünglichen Herrschaftsgebietes Besitz ergreifen konnte – er regierte
nur im einem Teil des Pandschab und im Gebiet um Delhi. In den nächsten
zwei Jahrzehnten gelang es dann Akbar, so jung er auch noch war, durch
hervorragende Feldzüge nicht nur die verlorenen Gebiete wieder zurück zu
erobern, sondern auch das Reich auf ganz Nordindien auszudehnen und einen
Teil von Dekkan dazu zu gewinnen sowie die nordwestliche Grenze bis nach
Kabul und Kandahar zu verschieben, d. h. seine Herrschaft umfasste
Nordindien, das östliche Afghanistan und einen Teil von Dekkan. Immer
stellte er sich selbst an die Spitze seiner Truppen.
Akbar organisierte eine exzellente Verwaltung des
Landes. Das Finanzwesen und das Steuersystem wurden von ihm neu geordnet.
Auf seiner Strukturierung und Vermessung des Landes hinsichtlich seiner
Größe und der erzielten Einkünfte – mit seiner Methode stand er ganz auf
der Höhe seiner Zeit – basierten die späteren Daten der Briten, als diese
in Indien ihre Herrschaft errichteten. Seine größte Leistung – er regierte
als absoluter Herrscher und war auch oberster Richter – aber bestand
darin, dass er – seiner Zeit weit voraus – um weltliche und religiöse
Toleranz bemüht war. Er versöhnte seine Hindu-Untertanen, indem er die
verhasste Kopfsteuer für Nichtmuslime, die Dschesija, abschaffte und
Hindus Zugang zu hohen Staats- und Militär-Posten gewährte; zudem
heiratete er Töchter hinduistischer Fürsten und machte sich diese dadurch
geneigt. Gelehrte Repräsentanten der einzelnen Religionen lud er zu
Diskussionen ein, um von ihnen zu lernen. Zunächst praktizierte er sogar
das eine oder andere Gebot aus diesen Glaubensvorstellungen, trug unter
seiner Kleidung das heilige Hemd der Zoroaster-Anhänger, gab wegen des
Dschainismus das Jagen auf, zeigte sich eine Zeit lang mit religiösen
Hinduzeichen auf der Stirn, was vor allem die Muslime empörte, und ließ
einen seiner Söhne von Jesuiten erziehen. Er heiratete Frauen aus
unterschiedlichen Glaubensrichtungen und verpflichtete die Religionen zu
einer Zeit zu gegenseitigem Frieden und Toleranz, als sich in Europa die
Anhänger der verschiedenen Religionen gegenseitig abschlachteten.
Schließlich versuchte er die Stiftung einer neuen Religion, die
»Din-i-Ilahi«, die »göttliche Religion«, genannt wurde und die Elemente
aus allen ihm bekannten Religionen, also der hinduistischen, islamischen,
christlichen und parsischen, enthalten sollte. Ziel war die Aussöhnung der
vielen teilweise verfeindeten und zerstrittenen Völker seines Reiches; die
Mehrheit seiner Untertanen war nichtislamisch, aber deren Loyalität wollte
er sich ebenfalls vergewissern. Ein Hintergrund für Akbars Bestrebungen
auf religiösem Gebiet ist wohl auch in seiner Verwurzelung im Sufismus,
der muslimischen Mystik, zu suchen. Die Überlegenheit des Menschen beruhe
auf dem Juwel der Vernunft, soll er andererseits gesagt haben, und er zog
das wissenschaftliche allem anderen Denken vor. Natürlich war der neuen
Religion kein Erfolg beschieden, aber Akbar trug damit zur Einheit des
Volkes bei, wenn er sich auch viele Muslime wegen seiner Abkehr vom Islam
zum Feinde machte. Ursprünglich scheint er wohl nicht besonders gebildet
gewesen zu sein; er lehnte es ab, lesen und schreiben zu lernen und
widmete sich als Jugendlicher ganz dem Sport, dem Reiten, Kämpfen, der
Dressur von Elefanten und der Tigerjagd. Aber er besaß einen
unersättlichen Wissensdurst und verfügte über die seltene Gabe, durch
Zuhören mehr zu lernen als andere durch Lesen, wobei ihm sein
hervorragendes Gedächtnis half. Dass er Handel, Wissenschaft und Künste
förderte – die indische Musik, Malerei und Poesie erlebten eine ihrer
glanzvollsten Epochen, indische Meisterwerke der Literatur, Wissenschaft
und Geschichte ließ er ins Persische, die Hofsprache, übersetzen, und
architektonische Bauten von großer Pracht entstanden -, verstand sich von
selbst. So fand er auch Zeit, eine Bibliothek aufzubauen, die 24.000 Bände
umfasste. Er verbot auch die Kinderehe und die erzwungene
Witwenverbrennung – Witwen durften wieder heiraten, und am Ende seiner
Regierung war sein Gesetzeswerk »wahrscheinlich der aufgeklärteste
Gesetzeskörper einer Regierung des 16. Jahrhunderts« (Durant). Persönlich
war er kein besonders schöner Mensch, hatte wohl einen schiefen Kopf,
mongoloide Augen und eine Warze auf der Nase, aber seine Würde,
Gelassenheit und Sauberkeit, vor allem aber seine strahlenden Augen – wie
»das Meer im Sonnenschein« sollen sie gemäß seinen Zeitgenossen geleuchtet
haben – machten ihn zu einer ansehnlichen Gestalt.
Die letzten Lebensjahre wurden Akbar dadurch
verleidet, dass sein ältester Sohn Selim gegen ihn rebellierte, wohl auch
in Opposition zu Akbars Abkehr vom Islam und Verkündung einer neuen
Religion. Zwar versöhnten sich Vater und Sohn wieder, aber Akbar starb
bald danach, vielleicht an gebrochenem Herzen, vielleicht an der Ruhr,
vielleicht an seines Sohnes Gift, in Agra am 17. Oktober 1605, ziemlich
einsam für einen derart erfolgeichen und humanen Herrscher, während um
sein Erbe schon gestritten wurde. Sein Grabmal befindet sich in Sikandra
bei Agra. Er hinterließ ein blühendes Land und konnte sich der Zuneigung
und des guten Willens der meisten seiner Untertanen sicher sein. Hören wir
noch einmal die Encyclopedia Americana; danach wird er als der
größte Herrscher angesehen, der der muslimischen Dynastie in Indien
entspross, und als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 16.
Jahrhunderts überhaupt. Aber auch sein Reich hatte nicht lange Bestand.
Seine Nachfolger gewannen zwar die Sultanate im Dekkan dazu, aber das
Riesenreich verlor dadurch auch an Stabilität und zerfiel in einen
lockeren Staatenbund, nachdem der persische Schah Nadir (geb. 1668; reg.
1736–1747 (ermordet)) 1739 Delhi erobert hatte. 1858 wurde der letzte
Mogulkaiser durch die Briten abgesetzt. Akbar hatte es trotz aller
Bemühungen nicht geschafft, eine Artillerie wie die in Europa übliche zu
erhalten, und so war die waffentechnische Überlegenheit der Engländer kein
Wunder. Dass Indien später britisches Vizekönigreich wurde, bis es 1947
unabhängig wurde, ist ein weiterer Teil seiner unruhigen Geschichte, in
der Akbars Regentschaft – wie die Aschokas – einen seltenen Höhepunkt
bedeutet hatte. Die Inder waren es, die ihren Kaiser Akbar, den Ȇberaus
Großen« betitelt haben. Er war sein Schicksal, wie ein Historiker – Durant
– schrieb, »einer der weisesten, humansten und gesittetsten Könige der
Geschichte zu werden«, und das zu einer Zeit, da in Europa immer wieder
das Chaos Oberhand über die Ordnung gewann.
2. Europa zwischen Ordnung und Chaos
Wie schon dargestellt, war Europa am Ende des Mittelalters und mit der
Neuzeit ein Sammelsurium von Einzelstaaten geworden, sowohl mächtigen
Gebilden wie Frankreich, England, Russland, Schweden, Habsburg, Spanien,
Portugal, die Niederlande oder mit Verspätung Preußen, als auch von
Kleinstfürstentümern, wie sie das damals immer noch existierende Heilige
Römische Reich Deutscher Nation zu bieten hatte. Krieg und Frieden lösten
einander ab; kaum etwas zu Ruhe und Ordnung gekommen, versank Europa in
bestimmten Teilen schon wieder im Chaos. War es hier ein Krieg um die
Ausdehnung der Macht, war es dort einer, die Machtansprüche
zurückzuweisen, oder ein »Erbfolgekrieg«. Von zivilisierter Welt konnte
nur die Rede sein, wo der Krieg nicht oder nur wenig hinreichte, und doch
entwickelte sich Europa kulturell und wirtschaftlich immer weiter, in
Anbetracht des verbreiteten Grauens ein Wunder. Wohl lag es mit daran,
dass Kriege im Allgemeinen territorial begrenzt waren und das »Volk« in
der Regel noch außen vor und häufig verschont blieb. Am Ende des
Dreißigjährigen Krieges allerdings, mit dem Westfälischen Frieden 1648,
nach einem grauenvollen Krieg, der sich von einem Religionskrieg zu einem
europäischen Machtkampf auf deutschem Boden entwickelt hatte, mit dem
gewaltigen Bevölkerungsverlust und der wirtschaftlichen Verelendung der
deutschen Lande im Gefolge, gab es in Deutschland fast 300
landeshoheitliche Einzelstaaten, die sich aber alle von höchster
Wichtigkeit wähnten und meinten, sich daran erfreuen zu müssen, auch wenn
sie im Geplänkel der großen Mächte nur eine untergeordnete Rolle spielten.
Einige wie Weimar wurden in der Tat sehr bedeutend. Auch im sonstigen
Europa fühlten sich noch etliche Kleinstaaten und vor allem ihre Herrscher
als ungemein wichtig. Aber ein paar dieser selbstständigen
Territorialstaaten hatten sogar noch »Große« zu bieten.
Streiter um Macht und Fortschritt: Edzard, Karl, Karl Ferdinand
und Maximilian die Großen
Ursprünglich Häuptlings-, später Fürstengeschlecht in Ostfriesland von
Bedeutung war das Geschlecht Cirksena, das aus der Stadt Norden stammte
und von Greetsil bei Emden aus seine Herrschaft ausübte. In den Blickpunkt
der Geschichte trat es mit Edzard Cirksena, der den friesischen
Freiheitsbund gegen Versuche aus allen Richtungen, Ostfriesland zu
unterwerfen, anführte und 1441 starb. 1464 wurde Ostfriesland geeint, und
nun erhielt Edzards Bruder Ulrich das Land als Reichsgrafschaft zu Lehen.
Am 15. oder 16. Januar 1462 wurde ein weiterer Edzard in Greetsil geboren,
Edzard I., der unter den Herrschern von Ostfriesland der bedeutendste war.
Er kam 1491 oder 1492 nach einer Pilgerfahrt nach Jerusalem an die Macht,
und seine Regierungszeit war geprägt von vielen Auseinandersetzungen mit
Gegnern. Vor allem der Krieg mit Sachsen, das Anspruch auf Ostfriesland
erhob, die »sächsische Fehde« 1514 bis 1518, war zermürbend, aber Edzard
gelang es, Ostfriesland erfolgreich als selbstständige Einheit zu
bewahren. Um den ungeteilten Bestand der Reichsgrafschaft zu sichern,
führte er 1512 die Primogenitur in seinem Lande ein, also die
Nachfolgeregelung nach dem Erstgeborenenrecht. Andere Kämpfe gab es um die
Stadt Groningen, die ihn als Herrn und Beschützer akzeptierte, aber nach
acht Jahren verzichtete er 1514 darauf. Zwar förderte Edzard in seinem
Lande die Reformation, aber allgemein erwies er sich in Glaubensfragen als
tolerant. Dies und seine moderne Verwaltungspolitik – unter anderem erließ
er neue Gesetze und reformierte die Münzprägung – trugen ihm beim Volk den
Titel »der Große« ein, und so findet man ihn auch noch heute in den
Enzyklopädien. Er starb am 14. oder 15. Februar 1528 in Emden. Unter einem
seiner Nachfolger, Edzard II. (1533 – 1599), der durch seine Heirat mit
Katharina, einer Tochter König Gustavs I. Eriksson Wasa von Schweden (geb.
1496 oder 1497; reg. 1523–60), das Ansehen seines Geschlechts beträchtlich
hob, brachen 1595 Kämpfe mit den ostfriesischen Ständen aus, die
sogenannte »Emder Revolution«, und von da ab war eine aktive Außenpolitik
Ostfrieslands unmöglich. 1654 starb das Fürstengeschlecht Cirksena aus,
und 1744 fiel Ostfriesland an Preußen.
Weiter im Südwesten, in Lothringen, machte ebenfalls ein »Großer« von sich
reden, Karl III. Das alte Lotharingen war schon 945 in zwei Teile, Ober-
und Unter-Lothringen geteilt worden. Aus Unter-Lothringen wurde nach
langer Geschichte und wechselnden Besitzern Belgien und ein Teil der
Niederlande, Ober-Lothringen konnte bis 1736 von eigenen Fürsten regiert
werden. Karl III. wurde am 18. Februar 1543 in Nancy geboren und folgte
nominell 1545 seinem Vater nach dessen Tode nach, de facto natürlich erst
1559 mit dem Erreichen der Volljährigkeit. Seine Mutter Christina, die
eine Prinzessin aus Dänemark war und für ihren noch unmündigen Sohn die
Herrschaft führte, schaffte es, sich gegenüber dem französischen
Königshaus zu behaupten, vor allem durch ihre spanienfreundliche Politik,
aber im März 1552 ließ der französische König Heinrich II. (geb. 1519;
reg. 1547–59), Lothringen und die Bistümer Metz, Toul und Verdun besetzen.
Heinrich II., der übrigens mit Katharina von Medici (1519–1589)
verheiratet war und dem es während seiner Herrschaft gelang, die
französische Königsmacht zu festigen, stand im Bunde mit den deutschen
Protestanten (Vertrag von Chambord) und führte von daher Krieg gegen
Kaiser Karl V. Den damals neunjährigen Karl ließ Heinrich an den
französischen Königshof bringen; Regent in Lothringen von Heinrichs Gnaden
wurde Nicolas de Lorraine-Mercœur. Aber das Schicksal meinte es gut mit
Karl. Er durfte im Januar 1559 Claudia von Valois, die Tochter Heinrichs
II., ehelichen, die ihm neun Kinder gebar – eines, die Tochter Elisabeth
(1574–1636), heiratete den Kurfürsten von Bayern Maximilian I. (geb. 1573;
reg. 1597–1651), der im Dreißigjährigen Krieg u. a. als Haupt der
Katholischen Liga Furore machte. Anlässlich der Hochzeit erhielt Karl auch
Lothringen zurück, wo er bis zu seinem Tode am 14. Mai 1608 in Nancy als
Karl III. regierte. Seine Leistungen begründeten später seinen Beinamen
»der Große«. Er förderte Kunst und Wissenschaft; so gründete er die
Universität Pont-à-Mousson. Ferner reformierte er das Finanz- und
Justizwesen und förderte die Wirtschaft – in seiner Zeit machte Lothringen
bedeutende Fortschritte auf allen Gebieten, die territorialen Zugewinne
dabei gar nicht zu zählen. Karl war am französischen Königshaus katholisch
erzogen worden, aber aus den Religionskriegen in Frankreich hielt er sich
lange heraus. Schließlich gab er doch seine Neutralität auf. Ab 1584
unterstützte er die katholische Liga, was dazu führte, dass
protestantische Truppen das Herzogtum verheerten. Diese waren auf dem Weg,
dem späteren König Heinrich IV. (geb. 1553; reg. 1589–1610 (ermordet)) zu
Hilfe zu eilen, und Heinrich IV. erklärte Lothringen 1592 den Krieg, aber
erst als Heinrich 1593 zum Katholizismus übergetreten war (»Paris ist eine
Messe wert«), schloss Karl ein Jahr später Frieden; sein Sohn und
Nachfolger Heinrich II. (1563 – 1624) heiratete Katharina von Bourbon,
eine Schwester König Heinrichs IV., womit die engen und freundschaftlichen
Beziehungen zwischen Frankreich und Lothringen deutlich wurden. Heinrich
IV. legte übrigens den Grundstein für den absolutistischen französischen
Staat und wurde als Idealherrscher in der Literatur verehrt. Manche sind
heute der Ansicht, er hätte den Titel »der Große« verdient gehabt.
Lothringen jedenfalls, dessen Herzog Karl V. Leopold (1643–1690) als
österreichischer Feldmarschall 1683 zu den Siegern über die Türken vor
Wien gehörte, kam 1736 als Entschädigung an den Exkönig von Polen
Stanislaus I. ( geb. 1677; reg. 1704–09 und 1733–1736, gest. 1766), der
sich im Polnischen Erbfolgekrieg nicht hatte durchsetzen können. Nach
seinem Tod verleibte Frankreich sich Lothringen ein, wo es, mit dem
Zwischenspiel des Elsass in deutschen Händen von 1871, dem deutschen Sieg
über Frankreich, bis 1919, dem Vertrag von Versailles, auch blieb.
Savoyen ist uns in unserer Geschichte der »Großen« bereits begegnet. Es
wurde erwähnt, dass das Land seit 1032/43 zum Heiligen Römischen Reich
gehörte. Die Grafen, die 1416 zu Herzögen erhoben wurden, erkoren das
oberitalienische Piemont zu ihrem Kernland. Einer der bedeutenderen
Vertreter dieser Herrscher war Karl Emanuel I. der Große. Er wurde in
Rivoli am 12. Januar 1562 als Sohn Emanuel Philiberts und Margarete
(1523–74), der Tochter des französischen Königs Franz I., der uns im
Zusammenhang mit der Ausbreitung des Osmanischen Reiches begegnet ist, aus
dem französischen Königsgeschlecht der Valois geboren. Als Herzog – seit
1580 – versuchte er wiederholt, Genf zu erobern, wenn auch immer ohne
Erfolg. 1588 besetzte er auch die französische Markgrafschaft Saluzzo. Der
eben genannte französische König Heinrich IV. überließ ihm das Gebiet im
Vertrag von Lyon 1601; dafür musste Karl Emanuel allerdings andere Gebiete
an Frankreich abtreten. Karl Emanuel ging sogar so weit, 1619 die Königs-
bzw. Kaiserkrone anzustreben, er bewarb sich regelrecht um die Krone,
hatte aber natürlich keine Chance; vielleicht wäre die Geschichte unter
ihm auch anders verlaufen; denn Kaiser wurde Ferdinand II. (geb. 1578;
König 1619 (vorher schon in Böhmen und Ungarn); Kaiser 1619; gest. 1637),
zu dessen ersten Maßnahmen die rigorose und brutale Unterdrückung des
Protestantismus gehörte und unter dem das Reich in den Dreißigjährigen
Krieg schlitterte. Aber auch Karl Emanuel war kriegerisch; von 1623 bis 26
beteiligte er sich auf französischer Seite am Krieg um das Veltlin.
Ansonsten hat er sich um Savoyen und Sardinien verdient gemacht. Er starb
am 26. Juli 1630 in Savigliano bei Turin. Da war der Dreißigjährige Krieg
bereits in vollem Gang. Seit 1720 stellten die Herzöge von Savoyen dann
die Könige von Sardinien – im Tausch gegen Sizilien, das Savoyen erst 1713
erhalten hatte, kam Sardinien an Savoyen. 1796 bis 1814 gehörte Savoyen zu
Frankreich, an das es 1860 endgültig fiel. Seit 1861 stellte das Haus
Savoyen aber immerhin die Könige von Italien. So ein relativ »kleines«
Haus – und doch zwei »Große« in der Geschichte … Aber andererseits: Wer
hätte dies von den Ostfriesen vermutet? Aber das ist kein Witz …

Maximilian I. (1598, Wikipedia)
Auch Bayern hat einen »Großen der Geschichte« hervorgebracht. Er wird zwar
nicht allgemein so genannt, aber in der Encyclopedia Americana,
die bei der Vergabe des Titels, wie wir schon mehrfach bemerkt haben,
etwas großzügiger ist, als in Deutschland üblich, finden wir das Stichwort
›MAXIMILIAN I (called THE GREAT)‹. Diese Bezeichnung erfolgte natürlich
nicht ohne Grund. Der spätere Herzog und Kurfürst von Bayern kam am 17.
April 1573 in München zur Welt. Im Alter von 24 Jahren wurde er nach der
Abdankung seines Vaters Herzog. Von den Jesuiten ausgebildet, gehörte er
zu den entschiedenen Gegnern der Reformation und entwickelte sich zum
Vorkämpfer der Gegenreformation. Als sich 1608 eine Anzahl
protestantischer Reichsstände zu einem Bund, der ›Union‹, zusammenschloss,
gründete Maximilian als rivalisierenden Bund die Katholische Liga, der
sich alle wichtigen katholischen Stände Süddeutschlands anschlossen. Die
Protestanten waren damals heillos zerstritten, so dass viele bedeutende
protestantische Länder der Union nicht beitraten. So blieb z. B. der
Kurfürst von Sachsen neutral. Zwei feindliche Lager standen sich von nun
ab gegenüber. Ein geringer Anlass würde genügen, zwischen Protestanten und
Katholiken einen Krieg auszulösen. Und der ergab sich bald. Es ist in
diesem Rahmen nicht möglich, näher auf den Dreißigjährigen Krieg
einzugehen, der 1618 ausbrach. Maximilian war an ihm maßgeblich beteiligt.
Nachdem er mit der Union einen Vertrag über deren Neutralität geschlossen
hatte, führte er Kaiser Ferdinand II., den wir eben im Zusammenhang mit
Karl Emanuel dem Großen erwähnt haben, die Katholische Liga zur
Unterstützung zu. In der Schlacht am Weißen Berg bei Prag 1620 besiegten
seine Truppen, befehligt von dem Grafen Johann T. von Tilly (1559–1632),
der aus Brabant stammte, den pfälzischen Kurfürsten und König von Böhmen
Friedrich V. (1596–1632). Im Vorfeld der Wahl Friedrichs zum König von
Böhmen 1619 war dieser übrigens von dem antihabsburgisch eingestellten
Karl Emanuel in Böhmen mit einem Heer gegen den habsburgischen Kaiser
unterstützt worden, der vorher schon Truppen nach Böhmen entsandt hatte;
das Heer Karl Emanuels nahm u.a. Pilsen ein und ebnete damit Friedrich V.
den Weg. Nach der Schlacht am Weißen Berg musste Friedrich, als
‚Winterkönig‘ verspottet und von Kaiser Ferdinand geächtet, allerdings
nach Holland ins Exil fliehen. Tilly eroberte und verwüstete daraufhin die
Pfalz, und Kaiser Ferdinand übertrug die Kurfürstenwürde 1623 von der
Pfalz auf Bayern. Damit wurde Bayern Kurfürstentum, Maximilian Kurfürst.
Auch die Pfalz wurde bayerisch. Als nächstes brachte sich Maximilian in
den Besitz der Oberpfalz, gab aber dem Kaiser Oberösterreich zurück. Im
Zusammenhang mit den Rivalitäten zwischen den Heerführern, zu denen der
Krieg unweigerlich führte, gelang es Maximilian 1630 zu erreichen, dass
der berühmte Herzog von Friedland und Mecklenburg Albrecht von Wallenstein
(1583–1634), obwohl im Krieg so erfolgreich, vom Kaiser entlassen wurde.
Ferdinand hatte Wallensteins Heer als Gegengewicht zu den Bayern
gebraucht, auf die er nicht allein angewiesen sein wollte, aber Maximilian
war nicht geneigt, einen mächtigen Nebenbuhler und einen übermächtigen
Kaiser zu dulden. Zwei Jahre später hatten sich allerdings die Zeiten
wiederum gewandelt: Die Schweden hatten mit französischer Hilfe München
erobert, Wallenstein wurde erneut berufen, und Maximilian brauchte dessen
Unterstützung gegen die Schweden und Franzosen. Nach langen Jahren des
Krieges schloss Maximilian mit den Schweden und Franzosen 1647 einen
Waffenstillstand, der aber von diesen schon bald gebrochen wurde; erneut
kamen die bayerischen Truppen in Bedrängnis. Erst der Westfälische Friede
1648 beendete den Dreißigjährigen Krieg; er wurde im Oktober 1648 auch in
München unterzeichnet. Maximilian ‚der Große‘ wurde als Kurfürst
bestätigt, die Würde in seiner Familie erblich. Später bekam aber auch die
Pfalz erneut die Kurwürde. Maximilian starb am 27. September 1651 in
Ingolstadt. Zweifellos war er eine herausragende Herrschergestalt, die
nicht nur Bayern, sondern auch die deutsche Geschichte in den Wirren des
Dreißigjährigen Krieges stark mit geprägt hat. Aber ob es zu ihrem Vorteil
war, das bleibe doch dahin gestellt.
Der Sonnenkönig: Ludwig der Große
In Deutschland firmiert er nur als Ludwig XIV., der »Sonnenkönig«. Als
Ludwig der Große ist er hierzulande nicht bekannt. Und doch: Er trägt den
Titel Le Grand, der Große, the Great, auch als Le Grand Monarch, the Great
Monarch, der Große Monarch wird er bezeichnet. Warum sich der Titel »der
Große« bei uns nicht eingebürgert hat, ist eine Frage der geschichtlichen
Entwicklung; vielleicht klang die Ehrenbezeichnung »Sonnenkönig«, the Sun
King, Le Roi Soleil, einfach nach mehr.
Geboren wurde der »Sonnenkönig« am 5. September
1638 in Saint-Germain-en-Laye als Sohn König Ludwig XIII. (geb. 1601; reg.
1610–43), dem Sohn Heinrichs IV., der uns eben schon begegnet ist. Mit
diesem hatte sich der Absolutismus in Frankreich durchgesetzt, der dann
unter Ludwig XIV. zur Hochform auflief. Bis 1661 stand letzterer unter der
Vormundschaft seiner Mutter Anna von Österreich (1601–1666). Ähnlich wie
während der Regierungszeit seines Vaters ein Kardinal die Regierung
bstimmte, nämlich Herzog Armand-Jean du Plessis Richelieu (1585–1642), so
unter ihm selbst bzw. seiner Mutter seit 1643 der Herzog und Kardinal
Jules Mazarin (1602 – 1661), der – wie schon Richelieu – der eigentliche
Herr in Frankreich und enger Vertrauter des Königs war. Als Mazarin starb,
übernahm Ludwig selbst die Führung des Staaates. Das Parlament verlor alle
Macht, der Adel wurde an den Hof gezogen, aber nur, um ihn von dort aus
einzubinden und zu kontrollieren (zu was war er da noch nütze, außer für
die Kriegsführung? – die Verwaltung seiner Güter war anderen überlassen),
kurzum der Absolutismus erhielt seine vollendetste Ausführung. Dies alles
geschah zu einer Zeit, als sich Frankreichs Staatssäckel dank der Politik
von Finanzminister Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay
(1619–1683), stetig füllten. Colbert war wohl der bedeutendste Vertreter
des Merkantilismus, in Frankreich sogar Colbertismus genannt, ein Begriff,
der die dirigistische Wirtschaftspolitik der absolutistischen Staaten
umschreibt: Die gewerbliche Wirtschaft wurde stark gefördert, freilich auf
Kosten der Landwirtschaft; die Infrastruktur wurde ausgebaut, ein
einheitliches Zoll- und Marktgebiet geschaffen; dazu kamen eine
Steuerreform, bestimmte Ausfuhrverbote und Produktionsvorschriften.
Colbert fasste die Wirtschaftskräfte zentralistisch zusammen und steigerte
sie im Lauf der Zeit gnz im Sinne einer Planwirtschaft. Nicht nur die
Industrie wurde gefördert, sondern auch der Bau von Straßen und Kanälen
und das Kolonialwesen, letzteres u. a. durch den Ausbau der Flotte. Durch
diese interventionistische Politik wurden Wirtschafts- und Finanzkraft des
französischen Staates anfänglich sehr gestärkt, aber die Vernachlässigung
der Landwirtschaft riefen auf Dauer hier und im Volk starke Unruhe und
Unzufriedenheit hervor. Ähnlich sorgte auch seine zentralistische
Innenpolitik für Spannungen. Ludwigs Motto war: »ein König, ein Glauben,
ein Gesetz!« Ludwig schaltete die protestantische Opposition aus, indem er
das Edikt von Nantes von 1598, das – von Heinrich IV. erlassen – den
Hugenotten, wie die französischen Protestanten bezeichnet wurden, freie
Religionsausübung und Sonderrechte zugestanden hatte, endgültig aufhob.
Die katholische Kirche andererseits benutzte er für seine Machtpolitik,
beschränkte sie aber ganz auf den geistlichen Bereich. Auch konnte sich
Colbert mit seiner Reform der Steuerpolitik nicht durchsetzen; die
Kriegspolitik Ludwigs beruhte zwar auf der Steigerung der Staatseinkünfte,
letztere ermöglichte die zahllosen Kriege, die Ludwig führte, und auch
dessen unglaublich verschwenderische Hofhaltung, aber am Ende stand der
Staatsbankrott. Bis Ludwig gewissermaßen vom Kriegsdämon besessen wurde,
zeigte er sich dem Volk im Großen und Ganzen durchaus als freundlicher und
menschlicher Herrscher. Aber all das änderte sich Ende der sechziger
Jahre. Bei den von Ludwig vom Zaune gebrochenen Kriegen denken wir
zunächst an den Devolutionskrieg (1667/68) und den Holländischen Krieg
(1672–79), beides Eroberungskriege gegen die Vereinigten Niederlande, die
mit dem Gewinn einer Reihe von Gebieten endeten. Der Pfälzische und der
Spanische Erbfolgekrieg (1688–1697 bzw. 1701–1714) führten zwar ebenfalls
zu Gebietszuwächsen, waren aber am Ende nur dazu angetan, Europa zu
zermürben; auf Einzelheiten können wir hier verzichten. Stets fanden sich
in Europa Koalitionen gegen Frankreich, dessen Hegemoniebestrebungen
entgegen getreten wurde. So erreichte zwar Frankreich unter Ludwig dem
Großen die politische und, was fast noch mehr wog, die kulturelle
Vorherrschaft in Europa – alle Fürsten, besonders die deutschen,
versuchten sich im Absolutismus und in der Nacheiferung der Pracht von
Versailles – aber militärisch waren ihm Grenzen gesetzt, und am Ende stand
der wirtschaftliche Niedergang. Als Ludwig die Freiheiten der Hugenotten
rigoros beschnitt, verließen 200.000 von ihnen Frankreich, auch das mit
ein Grund für den unaufhaltsamen Bankrott, der am Ende auch zu einer
Ursache für die Französische Revolution wurde. Rund drei Milliarden Livres
Schulden soll der Staat bei seinem Tod gehabt haben. Ludwig XIV. starb am
1. September 1715 in Versailles. Verheiratet war er seit 1660 mit Maria
Theresia, der Tochter König Philipps IV. von Spanien (geb. 1605; reg.
1621–1665); als diese 1683 starb, ehelichte er im Geheimen Franςoise
d’Aubigné, Marquise de Maintenon (1635–1719), kurz die »Maintenon«, die
seit 1669 seine Kinder erzogen und seine Gunst erlangt hatte. Mätressen
hatte Ludwig daneben genügend.
Nun, was ist vom Sonnenkönig geblieben? Zum
Beispiel Versailles als Zeichen seiner Prunksucht, aber auch als Zeichen
von Kunst und Kultur, das bis heute Bewunderung abnötigt. Man hat die
enormen Kosten beredet, aber nach Einschätzung verschiedener Historiker
sind die 75 Millionen Livres, die der Bau verschlungen hat, verteilt auf
die Jahre 1661 bis 1682, als das Schloss bezogen werden konnte – und der
Spiegelsaal wurde noch später erst fertig – noch als relativ nicht zu hoch
anzusehen. Immerhin wandte aber der Hof in dieser Zeit für sich 12 bis 14
% der Staatsausgaben auf. Dass Ludwig die Rechnungen für Versailles
vernichtet haben soll, da auch in seinen Augen zu hoch, ist ein modernes
(oder auch altes) Märchen. Ludwig förderte Kunst und Literatur in
verschwenderischem Ausmaß, weil ihm daran gelegen war, Frankreich auch
darin groß zu machen. Und Versailles blieb Vorbild für Generationen von
Fürsten, Symbol auch für die absolute Herrschaft der Monarchen. »L’etat
c’est moi! » – « Der Staat bin ich » – dieser Ausspruch, den man Ludwig
zuschrieb, charakterisierte den Absolutismus. Aber auch dieses Zitat ist
nicht gesichert; ob es Ludwig je äußerte, ist ungewiss; schon gar nicht
hat er es, wie behauptet, anlässlich einer Parlamentssitzung am 3. April
1655 von sich gegeben. Dass Parlament und Adel unter ihm nichts zu sagen
hatten, ist davon unberührt.
Persönliche Schicksalsschläge setzten dem König
zu: Sein einziger legitimer Sohn starb schon 1711; er verlor auch seinen
Enkel und seine Enkelin und ihren Sohn und andere mögliche Thronerben.
Sein Urenkel wurde als Ludwig XV. (geb. 1710; reg. 1715–1774) schließlich
sein Nachfolger. Sicher war Ludwig XIV. nicht das Ungeheuer, zu dem er von
manchen Historikern gestempelt wurde, und seine Armeen haben nicht mehr
Grausamkeiten verübt als die der anderen europäischen Mächte. Als die
Macht Frankreichs zu wachsen begann, zog das Volk mit; als Ludwig tot war,
kam die Stunde der Abrechnung. Die Bevölkerung war durch die Kriege so
reduziert worden, dass Eltern mit zehn Kindern eine staatliche Belohnung
erhielten. Das Volk war durch die hohen Steuern ausgeblutet, die
Wirtschaft lag danieder; die Last, die Ludwigs Nachfolger zu tragen
hatten, war zu schwer für sie, und die Französische Revolution und die
Herrschaft Napoleons waren die späten Folgen. Der große deutsche Dichter
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) meinte, in Ludwig habe die Natur
ein vollkommenes Beispiel des monarchischen Typus hervorgebracht und sich
dabei erschöpft und die Form gesprengt. Der schon mehrfach zitierte, da
abgewogene Urteile fällende Historiker Durant formulierte: »Er unternahm
verheerende Kriege, befriedigte seinen Stolz ausgiebig mit Bauten und
Luxus, unterdrückte die Philosophie und zog sein Volk bis zur Verelendung
aus; aber er gab Frankreich eine geordnete Regierung, die nationale
Einheit und eine glanzvolle Kultur, die ihm die unbestrittene Führung in
der westlichen Welt sicherte. Er war das Haupt und das Symbol der besten
Zeit seines Landes, und Frankreich, das vom Ruhme lebt, hat ihm verziehen,
daß er es beinahe zugrunde richtete, um es groß zu machen.« Der spätere
französische Kaiser Napoleon (geb. 1769; reg. 1804–1814/15; gest. 1821)
bezeichnete ihn – vielleicht als erster – als »großen König«. »Er war es,
der Frankreich in die erste Reihe der Nationen erhob. Welcher französische
König seit Karl dem Großen wäre ihm in allen seinen Aspekten zu
vergleichen?«
Kriegerische Reformer: Iwan, Peter und Katharina die Großen
Russland ist uns in unserer Geschichte schon mehrfach begegnet. Wir haben
gesehen, dass das große und bedeutende Kiewer Reich infolge von
Thronfolgestreitigkeiten bald zerfiel. Nach 1125 entstanden viele
Teilfürstentümer, und so wurde das einstmals blühende Reich im 13.
Jahrhundert relativ schnell Beute der Mongolen. Zwar rafften sich die
Fürsten zu einer gemeinsamen Aktion gegen die Mongolen auf, aber 1223
wurde ihr gemeinsames Heer an der Kalka vernichtend geschlagen. In den
Jahren 1237 bis 1240 eroberten die Mongolen grausam das gesamte russische
Territorium, sieht man von Nowgorod ab, das jedoch Tributzahlungen zu
leisten hatte. Kiew fiel 1240, und viele andere Städte erlitten ein
ähnliches Schicksal. Am Unterlauf der Wolga gründeten die Mongolen ein
eigenes Reich, das Reich der Goldenen Horde mit der Hauptstadt Sarai. Es
herrschte zweihundert Jahre lang über die russischen Fürstentümer und
verlangte ihnen Tribut ab. Diese Zeit war die düsterste Zeit der
russischen Geschichte. Das Land versank in Apathie. An den Folgen hat
Russland bis heute zu leiden.
In der Zeit nach der Eroberung durch die Mongolen
wurde das kleine Teilfürstentum Moskau immer mächtiger, das 1263 der
jüngste Sohn Alexander Newskijs, Daniel Alexandrowitsch (reg. 1263–1303),
als »Leibgedinge« erhalten hatte und immer größer und wohlhabender machte.
Zwischen 1317 und 1325 nahm der Metropolit hier seinen Sitz, was das
Ansehen des Fürstentums erhöhte. Wenig später – 1328 – verlieh der
Mongolenkhan dem Fürsten Iwan I. Kalita (reg. 1328–1340) die Würde des
Großfürsten; er hatte ein gutes Verhältnis zu den Mongolen und zog auch
die Kirche auf seine Seite; und er begann mit der Wiedervereinigung der
Gebiete des alten Kiewer Reiches. Das Ende der Mongolenherrschaft kam in
Sicht, als sie der Großfürst Dmitri Iwanowitsch Donskoi (reg. 1359–89)
1380 in der Schlacht auf dem Schnepfenfeld zum ersten Mal zu schlagen
vermochte. Über die Kämpfe Litauens um die Tatarengebiete im Südwesten und
Westen des russischen Reiches wurde schon berichtet, ebenso über die Union
von Litauen und Polen und die Konsequenzen für die Entwicklung in Mittel-
und Osteuropa. Seit dieser Zeit erfolgte die allmähliche Differenzierung
der slawischen Bevölkerung in Großrussen (Russen), Kleinrussen (Ukrainer)
und Weißrussen.
Den russischen Zentralstaat begründete der Moskauer Großfürst Iwan III.,
der später – wohl vor diesem Hintergrund und wegen des neuen Zeitalters
auf vielen Gebieten, das er einläutete – den Titel »der Große« erhielt.
Geboren wurde er am 22. Januar 1440 in Moskau und folgte 1462 seinem
Vater. Ihm ging es von Anfang an darum, die Machtstellung und den
Führungsanspruch Moskaus zu vergrößern. Von 1471 bis 1478 führte er daher
zwei grausame Kriege gegen Nowgorod, das nach wie vor eine Hauptmacht in
Russland darstellte, und es gelang ihm, die Stadt zu erobern und 1478 in
seinen Machtbereich einzugliedern. Dabei ging es sehr blutig zu. Außerdem
riss er die Gebiete und Herrschaftsansprüche seiner drei Brüder an sich;
das geschah 1463, 1474 und 1485. 1489 kam noch Wjatka hinzu. Zwischendurch
legte er sich mit den Mongolen an. Damals gab es mehrere mongolische
Reiche auf russischem Boden: Kasan, Astrachan (Sarai), das Reich auf der
Krim und die Horde der Nogaier. Sie alle bekämpften sich gegenseitig, so
dass es Iwan nicht schwer fiel, das tatarische Joch abzuschütteln. Er zog
1480 mit einem starken Heer gegen Sarai, aber ohne anzugreifen. Monatelang
passierte nichts; untätig stand Heer gegen Heer; dann zogen die Tataren
sich zurück. Ein Sieg? Nun, Iwan stellte die Tributzahlungen ein. Damit
beendete er die Mongolenherrschaft ziemlich unblutig. Einmal noch, 1521,
überfielen Mongolen Moskau und schlossen die Stadt ein, aber zogen sich
wegen ihrer eigenen Zerstrittenheit wieder zruück. Dafür stand im Süden
eine neue Macht bereit: das Osmanische Reich, das 1475 die Krim eroberte –
geführt von Mohammed dem Großen; wir hörten davon. Neben dieser bildete
auch das vereinigte Polen-Litauen eine Gefahr. Zweimal fiel Iwan in
Litauen ein, 1492 und 1501, um einen Zugang zum Meer zu erhalten, aber
erst 1503 erreicht er sein Ziel aufgrund eines Vertrages. Als kalt,
berechnend und herzlos ist uns Iwan überliefert, als grausam, der
Todesstrafen in reichem Maße verhängen und seine Gegner martern oder
umbringen ließ; allenthalben war er gefürchtet. Aber einen mäßigenden
Einfluss übte seine zweite Gemahlin auf ihn aus, wenn sie ihn auch in
seinen Allmachtsträumen unterstützte: Sophie (Zoë), die Nichte des letzten
byzantinischen Kaisers, die interessanterweise am päpstlichen Hof in Rom
ihre Ausbildung erhalten hatte. Mit ihr zog 1472 ein anderer Geist in
Moskau und damit in Russland ein. Hatte der Papst vielleicht gehofft, auf
diese Weise Russland für den Katholizismus gewinnen zu können, so scheint
Sophie ihre Ausbildung schnell vergessen zu haben. Moskau betrachtete sich
nun als Erbe von Byzanz und beanspruchte den Schutz der orthodoxen
Christen, die unter islamischer Herrschaft lebten – Iwan nahm den
zweiköpfigen byzantinischen Adler als neues Wappen Russlands auf und sah
in Moskau das »Dritte Rom«. Russlands Ansehen wuchs mit der Steigerung der
Autorität Moskaus, auch im Ausland. Auf einmal bemühten sich
westeuropäische Höfe um ein Bündnis mit dem Großfürsten; Gesandtschaften
nicht nur aus Litauen und Polen, sondern auch aus Rom, Ungarn, Venedig,
des deutschen Kaisers, der Türkei und Persiens machten ihre Aufwartung,
und mit Sophie kamen auch wieder Kunst und Kultur nach Russland, ja, es
zog eine neue kulturelle Epoche herauf. Byzantinische Gelerhte erschienen
mit ihren Büchern, die die Basis für Moskaus spätere reichhaltige
Bibliotheken bildeten; Künstler und Gelehrte aus Westeuropa erzogen Iwans
Kinder, bauten ihm Paläste, und Mönche vom Berg Athos übersetzten
griechische Bücher ins Slawische – alle fanden hervorragende Aufnahme an
Iwans Hof. Unabhängig davon ließ Iwan das Kriegswesen auf ganz neue Füße
stellen, und 1497 ließ er ein Gesetzbuch ausarbeiten, das das alte
russische Gewohnheitsrecht zusammenfasste und weiter entwickelte. Mit dem
Einfluss aus Byzanz entwickelte sich auch die autokratische Regierungsform
in Russland weiter. Der Adel büßte seine Rolle als Beratungsgremium des
Großfürsten ein und wurde Lehensnehmer von des Großfürsten Gnade.
Schließlich teilte er das Reich gemäß seinem letzten Willen nicht mehr
unter seine Kinder, sondern bestimmte einen einzigen Nachfolger. Damit
wurde Moskau stark und mächtig. Iwan starb am 27. Oktober 1505 in Moskau.
Schon lange vor Peter dem Großen öffnete Iwan der Große sein Land für
westliche Einflüsse.
Bis Peter der Große an die Macht kam, vergingen allerdings noch ein paar
hundert Jahre. Zum ersten Zaren des russischen Reiches, von »ganz
Russland«, wurde 1547 Iwan IV. der Schreckliche (geb. 1530; Großfürst
1533; Zar 1547 – 1584), der zahlreiche Reformen durchführte und das Reich
nach außen erweiterte und nach innen stärkte, unter anderem durch eine
neue Rechtskodifizierung (1550). Die tatarischen Reiche Kasan und
Astrachan wurden von ihm erobert, und unter ihm begann die Ausdehnung der
Russen nach Sibirien. Nach ihm setzte eine Ära des Verfalls und der Wirren
ein. Es kam zu Aufständen und dem Eingreifen von Polen und Schweden, die
sich die Lage zu Nutzen machen wollten. Ein Krieg und ein Aufstand nach
dem anderen lösten sich ab. 1610 fiel Moskau sogar für zwei Jahre in
polnische Hand, und der von dem Donkosaken Stepan Rasin (ca. 1630–1671
(hingerichtet)) 1670/71 angeführte Bauernaufstand brachte im ganzen
Südosten des Reiches, am Don und an der unteren Wolga, Krieg und Elend.
1613 wurde Michail Fjodorowitsch (geb. 1596; reg.
1613–1645) zum Zaren gewählt; er schloss 1617 mit Schweden und 1618 mit
Polen Frieden, was aber sein Land nicht vor weiteren zukünftigen Kriegen
und Aufständen bewahrte; er war es, der die Dynastie Romanow begründete,
die bis 1917 regieren sollte. Ihr entstammte auch Peter I. der Große.
Geboren wurde er am 9. Juni 1672 in Moskau als Sohn des Zaren Alexei
Michailowitsch (geb. 1629; reg. 1645–1676), unter dessen Herrschaft die
Russen in Sibirien die chinesische Grenze erreichten und der Aufstand
Stepan Rasins niedergeschlagen wurde. Ihm folgte sein Sohn Fjodor III.
(geb. 1661; reg. 1676–1682), ein kränklicher Herrscher, der mit der
Modernisierung des Heeres begann und den 1. Russisch-Türkischen Krieg 1681
beendete, wenn auch ergebnislos. Er war ein Halbbruder Peters, nach seinem
Tod kam aber noch nicht Peter an die Reihe, sondern dieser und sein
debiler Halbbruder Iwan IV. (geb. 1666; gest. 1696) wurden Co-Zaren,
während seine ältere Halbschwester Sophia (1657–1704) für sie beide die
Regentschaft führte. 1689 erzwang Peter dann das Ende von Sophias
Herrschaft, als sich das Gerücht verbreitete, er solle ermordet werden,
und übernahm selbst die Macht. Er hatte, während er zurückgezogen lebte,
ein »Spielregiment« aus echten Sodlaten aufgebaut, den Kern seines
späteren Heeres, mit dem er in einer »Spielfestung« in einem Moskauer
Vorort übte. Dieses Spielregiment, mit dem er auch den Bau und das
Navigieren von Schiffen trainiert hatte, kam ihm jetzt zu Hilfe, und
Sophia wurde in ein Kloster geschickt. Erst als Iwan starb, kam Peter
vollständig zur Macht. Bis zu ihrem Tod 1694 hatte dann noch Peters Mutter
Natalya regiert.
Wie auch Iwan der Große zeigte Peter vielfältige
Charakterseiten. Schon 1695 stürzte er sich einerseits in den Krieg und
eroberte mit seiner neuen Flotte ein Jahr später die türkische Festung
Asow. Andererseits begab er sich in den beiden Jahren danach inkognito u.
a. nach England und in die Niederlande, um dort den Schiffsbau zu
erlernen, allerdings auch, um eine Allianz mit Polen gegen Schweden zu
bilden. Wieder zurück hielt er 1698 ein blutiges Strafgericht über die
Strelitzen, die in seiner Abwesenheit einen Aufstand geführt hatten. Es
war nicht der erste dieser von Iwan IV. gegründeten Elitetruppe, die als
Grenzschutz und Leibwache diente; zu Peters Zeit waren es etwa 55.000; sie
lebten in eigenen Siedlungen; ihre Dienstpflicht war lebenslang und
erblich. Peter löste die Truppe auf und begab sich nun mit Feuereifer an
Reformen, um sein Reich für Westeuropa zu öffnen und dessen
Errungenschaften anzugleichen. Es ging ihm um die Europäisierung
Russlands; dazu ließ er sich auch von ausländischen Experten – darunter
waren auch Deutsche – beraten. Mit diesem Ziel führte er eine Städterefom
durch (1699), erließ eine Gouverneurs-Ordnung (zwischen 1708 und 1719). Er
führte die westeuropäische Kleiderordnung und Etikette ein (auf Bärte war
eine Zeitlang eine Steuer zu entrichten); er reorgansierte das Heer und
erließ 1722 eine Rangtabelle zur Schaffung eines neuen Dienstadels; 1721
griff er in Kirchenangelegenheiten ein und ersetzte das Patriarchat der
Orthodoxen Kirche durch den »Heiligsten Regierenden Synod«, womit er die
Kirche der staatlichen Kontrolle unterstellte; zehn Jahre vorher hatte er
schon einen Regierenden Senat in weltlichen Angelegenheiten gegründet, der
nur ihm verantwortlich war; damit hatte er den Adel, die Bojaren, vollends
entmachtet. Umgekehrt überantwortete er viele Bauern der Leibeigenschaft.
Eine seiner wichtigsten Leistungen bestand in der Gründung der späteren
Hauptstadt St. Petersburg 1703, mit dem er sich endgültig von der alten
russischen Welt, die mit Moskau verknüpft war, lösen wollte. Man kann
seine mit ungeheurer Schnelligkeit durchgeführten Reformen, der seine
Untertanen kaum oder gar nicht folgen konnten, auch in folgende
Modernisierungen gliedern: Reform des Kalenders, Bildung einer regulären
Armee und einer Marine, Gründung von etwa 200 Fabriken einschließlich
einer Eisenindustrie im Ural-Gebirge, die zu seiner Zeit die weltweit
größte war, Einführung eines neuen Steuersystems, Veröffentlichung der
ersten einheimischen Zeitung, Bau eines Kanals von der Wolga zur Ostsee,
Eroberung der Ost- und Südküste des Kaspischen Meeres, Organisation eines
Netzes technischer Schulen, Planung einer Russischen Akademie der
Wissenschaften, deren Gründung 1725 bald nach seinem Tode erfolgte (1755
wurde die Moskauer Universität gegründet). Diese Errungenschaften zählt in
dieser Reihenfolge die Encyclopedia Americana auf. Noch viele
weitere wären hinzuzufügen, so die Einleitung der Erforschung Sibiriens –
die »Große Nordische Expedition«. Bei all den Reformen wurde Peter durch
Kriege in Anspruch genommen. Im Nordischen Krieg (1700–1721) gegen
Schweden siegte er nach einer schweren Niederlage (1700 bei Narwa) 1709
bei Poltawa entscheidend und löste 1721 mit dem Frieden von Nystad
Schweden als Hauptmacht an der Ostsee ab; damals erwarb Russland Livland,
Estland, Teile von Karelien u. a. Ja, Russland stieg damit zur
europäischen Großmacht auf. Peter führte auch Krieg gegen das Osmanische
Reich, 1710/11, und gewann durch einen Feldzug gegen Persien 1722/23 große
Territorien an der West- und Südküste des Kaspischen Meeres, wie schon
gerade erwähnt.
Die Schattenseite Peters zeigte sich darin, dass
er außerordentlich grausam und tyrannisch war. Da die Kosaken in der
Ukraine die Schweden unterstützten, zerschlug er die ukrainische
Autonomie, beließ ihr aber noch gewisse Sonderrechte. Am schlimmsten
zeigte sich seine Brutalität in der Behandlung seines eigenen Sohnes
Alexei (gest. 1718) aus erster Ehe (1689–98; mit Jewdokija Fjodorowna
Lopuchina, die er nach gescheiterter Ehe in ein Kloster schickte), für den
er ein übermächtiger Vater war, so dass er zu fliehen versuchte, den er
aber zurückholen bzw. ausliefern ließ und dem er den Prozess machte; es
heißt auch, er habe ihn eigenhändig erschlagen. In zweiter Ehe war Peter
übrigens seit1712 mit Marta Skawronskaja verheiratet, die nach seinem Tode
– am 9. Juni 1725 in Moskau – zur Zarin Katharina I. (geb. 1684; reg.
1725–1727) aufstieg. Peters Kriege, der Aufbau von Heer und Flotte und die
Errichtung von St. Petersburg kosteten Unsummen Geldes, das durch Steuern
aufgebracht werden musste. Peters Volk stand unter großem Druck seitens
seiner Maßnahmen, der sich in mehreren Aufständen entlud, so in Astrachan
1705/1706 oder in der Bauernerhebung am Don 1707/08. Sie wurden von Peter,
der 1721 den Kaisertitel annahm, blutig unterdrückt.
Man hat Peter schon ganz negativ gesehen, aber
auch hier halten sich positive wie negative Leistungen die Waage. Er
selbst nannte sich »Imperator«, »Vater des Vaterlandes«, »Zar von
Moskowien«, »Kaiser aller Reußen« und auch »der Große«; bei dem
Kaisertitel folgten ihm allerdings die westeuropäischen Könige nicht,
abgesehen von dem preußischen König Friedrich Wilhelm I. (geb. 1688; reg.
1713–40) – die Königskrone hatte sich schließlich dessen Vater
ursprünglich selbst aufgesetzt, und er war damals auch nicht König von
Preußen, sondern in Preußen, was sich erst später ändern sollte. Aber der
Titel Peter der Große hat sich eingebürgert und die Zeitläufte überstanden
...
Iwan der Große hat in Russland das Tatarenjoch abgeschüttelt, Peter hat
das Reich groß und mächtig gemacht und nach Westen geöffnet, wenn auch
seine übereiligen Reformen vielfach stecken geblieben sind, und Katharina
die Große? – Von ihr weiß man, wenn überhaupt, noch etwas im Zusammenhang
mit den Potemkischen Dörfern und ihrem angeblich ausschweifenden
Liebesleben. Aber natürlich hat sie nicht von daher ihren Ehrentitel.
Katharina hieß ursprünglich Sophie Friederike Auguste und war die Tochter
des Fürsten Christian August von Anhalt-Zerbst in Stettin, wo sie – am 2.
Mai 1729 – auch geboren wurde. Als sie sechzehn war, wurde sie mit dem
russischen Thronfolger Peter vermählt; dieser, geboren 1728, war ein Enkel
Peters des Großen und kam in Kiel zur Welt; als Herzog von
Holstein-Gottorp (seit 1739) wurde er 1742 nach Petersburg gerufen, wo ihn
seine Tante, die Kaiserin Elisabeth (geb. 1709; reg. 1741–1762), die
Tochter Peters des Großen, als Thronfolger vorsah. Sie war es, die Peter
mit Katharina verheiratete. Die Ehe verlief unglücklich; siebzehn
verlorene Jahre, voller öffentlicher Demütigungen und
Scheidungsandrohungen, musste Kathatrina ertragen; nur ihr gutes
Verhältnis zur Kaiserin ließ sie alles überstehen. Ein Kind gebar
Katharina, den späteren Zaren Paul I. (geb. 1754; reg. 1796–1801), den sie
ihre Abneigung spüren ließ und den sie auch von allen Staatsgeschäften
fernhielt. Ganz anders war ihr Verhältnis zu ihrem Enkel, dem späteren
Zaren Alexander I. (geb. 1777; reg. 1801–25), dessen Erziehung sie sich
widmete und den sie im Geist der Aufklärung ausbilden ließ. Katharina
selbst war ebenfalls hoch gebildet und in jungen Jahren dem Geist der
Aufklärung verbunden. Nach dem Tode der Kaiserin bestieg Peter als Zar
Peter III. den Thron. Für Russland hatte er überwiegend nur Verachtung
übrig; er war ein glühender Anhänger des preußischen Königs Friedrich dem
Großen, den seine Tante im Siebenjährigen Krieg bekämpft hatte, und einer
seiner ersten Taten war, dass er mit ihm Frieden schloss, was Friedrich
dern Großen vor der Katastrophe im Krieg bewahrte. Als Peter dann noch
beschloss, russische Truppen gegen Dänemark auszusenden, die sein
Herzogtum Holstein unterstützen sollten, gab das den Ausschlag für eine
Revolte gegen ihn, hinter der wohl Katharina steckte. Gardeoffiziere
stürzten ihn, aber seine Ermordung am 17. Juli 1762 erfolgte unter nie
aufgeklärten Umständen, und ob sie von Katharina gebilligt war, lässt sich
endgültig auch nicht mehr feststellen. Sie zeigte mehr Interesse und
Sympathie für das russische Volk als ihr Mann, obwohl sie »nur« eine
deutsche Prinzessin war, noch dazu von nicht besonders hohem Adelsrang,
aber sie hatte es verstanden, sich am Hof Einfluss und Freunde zu
verschaffen. Am 9. Juli 1762 wurde sie zur Kaiserin ausgerufen. Fünf Jahre
später berief sie eine Gesetzgebende Kommission ein, deren Mitglieder
überwiegend in ständischen Wahlen bestimmte Abgeordnete waren – sie
legitimierte ihre Thronbesteigung im Nachhinein. Diese Versammlung sollte
Reformen im Sinne der Aufklärung erarbeiten, aber wurde schon nach zwei
Jahren wieder aufgelöst, ohne die Chance gehabt zu haben, nur eine einzige
Refom zu entwerfen. Nichtsdesotweniger musste Katharina stets darauf
achten, ihre Macht zu konsolidieren. Sie verteidigte den Orthodoxen
Glauben (1744 war sie übergetreten und trug seitdem den Namen Katharina)
und trat für Russlands Größe ein, aber sie übte religiöse Toleranz wie in
Europa neben ihr nur Friedrich der Große. Die Unterstützung des Adels
gewann sie durch verschiedene Maßnahmen. Die Staatsgeschäfte überließ sie
nicht ihren Ministern, sondern sie begriff sich als verantwortliche
Monarchin und galt als sehr fleißig. Wie viele Herrscher ihrer Zeit war
Katharina in ihrer Regierung zwiegespalten. Einerseits setzte sie Reformen
in Gang; so verselbstständigte sie die Gouverneure (1764) und führte die
Statthalterschaftsverfassung ein (1774). 1785 folgte die Charta der
Städte, womit die städtische Bevölkerung mehr Eigenverwaltung erhielt;
aber durch die Vermehrung der Posten aufgrund der Maßnahmen stiegen in
erster Linie die Kosten, weniger hob sich das Niveau der Verwaltung. Und
zu einer Zeit, als sie sich als Schülerin von Voltaire und dem Philosophen
und Schriftsteller Denis Diderot (1713–1784) bezeichnete und mit den
französischen Enzyklopädisten korresponierte, überantwortete sie viele
leibeigene Privatbauern den grundbesitzenden Adligen, schenkte sie zum
Teil ihren Günstlingen und Freunden, und beendete die Sonderstellung der
Ukraine, wo sie auch die Leibeigenschaft einführte. Viele ihrer
Reformankündigungen im Geist der Aufklärung erwiesen sich als reine
Rhetorik, und sie hat das Los der armen Bevolkerung weder gelöst noch ist
sie es aktiv angegangen. Auch sonst stärkte sie eher die alte Ordnung, als
dass sie neue Impulse vermittelte. Gegen die Übergriffe des Adels und auch
gegen ihre Politik erhob sich 1773 ein großer Teil der Kosaken und Bauern
des Ural unter dem Donkosaken Jemeljan I. Pogatschow (geb. ca. 1742), der
sich für den ermordeten Peter III. ausgab und dessen Ziel die Errichtung
eines Bauernstaates unter einem Bauernzar war; nach anfänglichen Erfolgen
wie der Eroberung Kasans wurde er 1774 besiegt und – von seinem Kumpanen
ausgeliefert – 1775 in Moskau hingerichtet. Die Niederschlagung des
Aufstandes beendete jede Hoffnung auf Besserung des Loses der Bevölkerung;
ganz im Gegenteil erhielt der Adel 1785 noch mehr Rechte in der lokalen
Selbstverwaltung und dadurch auch noch mehr Rechte über die Bauern. Sicher
sah Katharina in der Ausbeutung der Starken durch die Schwachen ein Übel,
aber sie hielt es wohl für über ihre Mittel gehend, es zu kurieren, wie
der Historiker Durant urteilte. Während sie einerseits selbst Satiren,
Fabeln oder Stücke sowie politische und historische Abhandlungen schrieb,
drückte sie ihrem Volk als erste in Russland die Zensur auf. Sie
korresponierte mit führenden Denkern und Staastmännern ihrer Zeit und
schrieb sogar ihre Memoiren; andererseits verfolgte sie russische
Schriftsteller. Sie betätigte sich als große Kunstsammlerin; die Eremitage
in Petersburg, die auf sie zurückgeht, ist noch heute berühmt und Zentrum
der Weltkunst. Andererseits bekämpfte sie entschieden alle Ideen der
Französischen Revolution, die sich auf Russland auswirken konnten.
Die andere Seite der Kaiserin zeigte sich in
ihrer Besiedlungs- und Machtpolitik. Im Süden – »Neurussland« – legte der
russische Feldherr und Staatsmann Potemkin (Grigori Alexandrowitsch
Potjomkin; 1739–1791) als Generalgouverneur – er war seit 1774 Katharinas
Günstling und Liebhaber und seit 1776 Reichsfürst – neue Siedlungen an.
Katharina warb im Rahmen ihrer Kolonisierungspolitik viele Einwanderer aus
Mittel- und Südosteuropa an; damals entstanden auf diese Weise zum
Beispiel die deutschen Wolgakolonien. Als 1787 Katharina von Potemkin zu
einer Reise in die neu besiedelten Gebiete eingeladen wurde, soll er ihr
und ihrer Begleitung, zu der viele Diplomaten, der englische und
französische Botschafter und sogar der österreichische Kaiser Joseph II.
(geb. 1741; König 1764; Kaiser 1765 neben seiner Mutter Maria Theresia;
gest. 1790), gehörten, mit Dorf-, Palast- und Gefechtsschiffsattrappen
einen nicht vorhandenen Reichtum des Landes vorgetäuscht haben – daher der
Ausdruck von den Potemkinschen Dörfern. Aber die Unterstellung der
Vorspiegelung falscher Tatsachen beruhte nicht auf Berichten von
Reisebegleitern, sondern entstand am Hofe Katharinas durch lästerliche
Zungen und wurde durch einen sächsischen Diplomaten in Umlauf gebracht und
im Lauf der Zeit zu einem immer mehr aufgebauschten bösen Gerücht; mag
Potemkin auch die eine oder andere »Verschönerung« vorgenommen, ja mögen
seine Pläne sich nicht in vollem Umfang erfüllt haben, so hat er doch für
»Neurussland« sehr viel geleistet, und Joseph II. ließ sich von Macht und
Größe Russlands beeindrucken. Wären die schweren Gefechtsschiffe in
Wirklichkeit nur getarnte Holzbötchen gewesen, wäre Europa wohl kaum von
der Stärke der Schwarzmeerflotte Russlands überzeugt worden. Aber es war
wohl auch der nach wie vor vorhandene riesige Gegensatz zwischen dem
russischen Hof mit seiner verschwenderischen Pracht und dem armseligen
Leben des Volkes, das im mehr oder weniger aufgeklärten Europa zu dem
Vorurteil führten, Russland sei ein zurück gebliebenes, elendes Reich,
dessen Wohlstand man vorgaukeln müsste. Dabei war all das, was Potemkin
oder Katharina erreichten, keineswegs »von Pappe«. Potemkin besetzte 1783
die Krim; er gründete Städte wie Cherson oder Sewastopol, und hier ließ er
die Schwarzmeerflotte aufbauen. Im Krieg gegen die Türken 1787 bis 1792
war er der Oberbefehlshaber des Heeres und der Flotte. Schon im ersten
Krieg gegen das Osmanische Reich 1768 bis 1774 wurde das Nordufer des
Schwarzen Meeres eingenommen. Mit den Friedensschlüssen 1774 bzw. 1792
(Jassy) hatte Russland einen wichtigen und ausgedehnten Zugang zum
Schwarzen Meer errungen; das Reich erstreckte sich nun bis zum Dnjestr und
zum Bug; die Krim und einige Teile des Kaukasus hatte es sich angeeignet;
außerdem wurde Russland ein Interventionsrecht beim Sultan zugunsten der
Donaufürstentümer eingeräumt, und russische Handelsschiffe durften durch
den Bosporus und die Dardanellen ins Mittelmeer fahren. Durch die
polnischen Teilungen 1772, 1793 und 1795 gewann Russland weitere Gebiete,
1795 gliederte es noch das Herzogtum Kurland ein.

Katharina die Große
(1780er Jahre, Wikipedia)
Man hat geltend gemacht, schon zu Lebzeiten und später in der
Geschichtsschreibung, Katharina habe sich als Frau ohne moralische Skrupel
in die Abhängigkeit ihrer Günstlinge und Liebhaber begeben – sie hatte
nacheinander zehn, alle hatten Posten in der Regierung, und drei, vor
allem Potemkin, hatten beträchtlichen Einfluss – die sie ausgenutzt und
sie für ihre Zwecke missbraucht hätten. Aber diese These ist doch zu kurz
gegriffen. Katharina die Große träumte von einem großen und mächtigen
Russland, vielleicht sogar von einer Wiederauferstehung des alten
byzantinischen Reiches und eines Reich Dakien auf dem Balkan. Zumindest
hat sie es erreicht, die Stellung Russlands in Europa zu festigen und zu
stärken. So erhielt sie sogar eine schiedsrichterliche Rolle in Europa.
Nach dem Ende des Bayerischen Erbfolgekrieges im Frieden von Teschen 1770
wurde Russland neben Frankreich Garantiemacht in deutschen
Angelegenheiten. Auch ihr Hof wurde zu einem Mittelpunkt in Europa,
diplomatisch und noch mehr auf kulturellem Gebiet. Als sie am 17. November
1796 im heutigen Puschkin (Zarskoje Selo) an einem Schlaganfall starb,
hinterließ sie ein außenpolitisch und kulturell erneuertes und gestärktes
Russisches Reich, und ihr Titel »die Große« zeichnet sie bis heute aus.
Peter der Große ging es vor allem um die Technik, als er den Anschluss an
den Westen suchte, Katharina um die Kultur – sie riss die gebildete
russische Elite aus dem Mittelalter mit in die Moderne. Die Urteile über
sie waren überwiegend positiv: »Sie war jeder Zoll ein ‚politisches
Wesen’, in der modernen Geschichte unerreicht von keiner Vertreterin ihres
Geschlechts und dennoch gleichzeitig durch und durch Frau und eine große
Dame« – so ein deutscher Historiker. Sie war »die einzige Herrscherin, die
Englands Elisabeth an Fähigkeit übertraf und ihr in der dauernden
Bedeutung ihres Werkes gleichkam« – ein englischer Historiker. Und
schließlich ein französischer, der sie zu ihren Gunsten mit Le Grand
Monarque verglich: »Der Großmut Katharinas, der Glanz ihrer Regierung, die
Pracht ihres Hofes, ihre Institutionen, ihre Bauten, ihre Kriege waren für
Rußland genau das, was das Zeitalter Ludwigs XIV. für Europa war; doch
individuell betrachtet, war Katharina größer als dieser Fürst. Die
Franzosen begründeten den Ruhm Ludwigs, Katharina begründete den der
Russen.«
Der Weg Russlands war noch steinig und
tränenreich. Am Ende standen die Revolution von 1917, die Stalin-Ära und
die Sowjetunion, aber danach kamen Gorbatschow und Glasnost, dann
allerdings Putin ...
Der Alte Fritz: Friedrich der Große
Viele Geschichten ranken sich um den »Alten Fritz«. Was wir von unseren
Eltern und Großeltern, die zumeist Verehrer von Friedrich dem Großen
waren, und aus der Schule mitgenommen haben, ist vor allem seine
Aufgeklärtheit, seine religiöse Toleranz – in seinem Staat könne jeder
nach seiner Faςon selig werden, hat er einmal gesagt; in anderern
europäischen Staaten bestimmte der Fürst die Religion seiner Untertanen.
Ein weiteres Beispiel ist die Einführung der Kartoffel, die ursprünglich
aus Amerika kam und schon während des Dreißigjährigen Krieges in manchen
Gegenden angebaut wurde. Da die Bauern nichts damit anfangen konnten oder
sogar die oberirdischen Früchte aßen, was zu schlimmen Vergiftungen
führte, ließ der Alte Fritz die staatlichen Kartoffelfelder zum Schein
bewachen, worauf die Bauern die vermeintlich so wertvolle Frucht stahlen,
um sie dann selber anzubauen. Auf einem ganz anderen Gebiet gibt es
ebenfalls Überlieferungen. Als 1775 in Amerika der Unabhängigkeitskrieg
ausbrach, der die Loslösung der englischen Kolonien von England und am
Ende die Gründung der Vereinigten Staaten zur Folge hatte, verpachteten
(»verkauften«) deutsche Fürsten freiwillige, meist aber zum Militärdienst
gepresste junge Untertanen nach England, in dessen Auftrag sie dann in
Amerika Dienst taten und gegen die Aufständischen kämpften. Die meisten
Untertanen vermietete der Landgraf von Hessen-Kassel, so dass alle
deutschen Soldaten in englischen Diensten in Amerika »Hessians« genannnt
wurden. Allen Fürsten, die Rekruten »verkauften«, ging es natürlich um die
Finanzierung ihrer üppigen Hofhaltung. Als das Ansinnen, Soldaten für
England zu stellen, an Friedrich heran getragen wurde, der über die besten
Truppen in Europa verfügte, lehnte er schroff ab. Wollte er nicht, dass in
Amerika Deutsche auf Deutsche schießen sollten? Andererseits unterstützte
er auch die Aufständischen nicht direkt; er mochte zwar den Tabak, aber
nicht die Tabak anbauenden Kolonisten, und als es amerikanischen
Abgesandten in Europa darum ging, in Europa Verbündete gegen England zu
gewinnen, weigerte er sich zunächst sogar, sie zu empfangen. Eine Audienz,
die dann endlich zustande kam, führte nur zu vagen Zusagen. Als aber von
England angemietete deutsche Rekruten durch preußisches Gebiet ziehen
sollten, lehnte dies Friedrich ebenfalls ab. Man hat später behauptet,
Friedrich hätte Viehzoll für den Durchzug verlangt, weil die Soldaten wie
Vieh nach England verkauft würden, wie er in einem Brief an Voltaire
geschrieben haben soll, aber die Forderung nach Viehzoll war wohl eines
der Propagandamärchen der Amerikaner, um den Briten zu schaden.
Tatsächlich hat Friedrich den Durchzug der Anhalt-Zerbster Rekruten durch
preußisches Gebiet untersagt und damit indirekt der amerikanischen Sache
sehr genützt, weil die Verstärkung der Briten dann erst so spät in Amerika
eintraf, dass der englische Befehlshaber unschlüssig, auch im Zweifel
bezüglich der zukünftigen Unterstützung aus der Soldatenverpachtung, mit
Angriffen wartete und damit der zerlumpten amerikanischen Armee und ihrem
Befehlshaber George Washington (1732–1799) die Ruhe schaffte, sich wieder
einigermaßen zu erholen. Wie Friedrich Kapp, der dem König nicht eben sehr
wohl gesonnen war, schrieb: »Eben darin liegt die Bedeutung der Politik
Friedrichs für den amerikanischen Krieg. Sie war in ihren Folgen für
Washington so viel wert wie ein neuer Bundesgenosse: Sie gönnte ihm Zeit
zur Erholung und half das Kriegsglück wenden. Ohne es zu wollen, erwies
also der große König dem republikanischen Feldherrn einen wesentlichen
Dienst.« Das geschah Anfang 1778; damals begann der deutsche General
Friedrich Wilhelm von Steuben (1730–1794) mit der Reorganisation des
amerikanischen Heeres; nur durch seinen Einfluss und mit Hilfe der von ihm
durchgeführten Ausbildung machte er aus den elenden Soldaten Washingtons
eine den besten englischen (d.h. meist deutschen) Truppen ebenbürtige
Armee – Steuben hatte zwar im Siebenjährigen Krieg gedient, aber nur, weil
er sich als »General im Dienste des Königs von Preußen« ausgab – Friedrich
war in Amerika sehr geachtet – fand er bei der amerkanischen Armee
überhaupt Aufnahme – eine Hochstapelei, die die englische Krone ihre
Kolonien in Amerika kosten sollte. Friedrich hatte an Voltaire über die
zum Kriegdienst gepressten jungen Leute geschrieben, dass ihm die armen
Kerle leid täten, die ihr Leben so unglücklich und sinnlos in Amerika
hingeben müssten. Friedrich Kapp weist die spätere Deutung einiger
amerikanischer Politiker und deutscher Geschichtsschreiber zurück,
Friedrich hätte aus Sympathie für die Rekruten oder gar die Amerikaner das
Durchzugsverbot ausgesprochen – er argumentiert, dasss Friedrich in seinen
Kriegen Hunderttausende ohne Rücksicht auf Verlust in den Tod schickte und
somit von ihm kein besonderes Mitleid mit den Soldaten zu erwarten war –
sondern es ging Friedrich wohl nur darum, England zu schaden, ohne zu
ahnen, wie weit reichende Folgen das haben würde, und Kapp zitiert auch
den Friedrich zugeschriebenen Ausspruch der Verwunderung, dass »die Hunde
von Grenadieren ewig leben wollen«. Dieser Satz, bekannter in der Form
»Hunde, wollt Ihr ewig leben?«, ist zwar eines der verbreitetsten Zitate
Friedrchs, aber er ist nicht belegt. Viel weniger bekannt, aber
nachgewiesen ist dagegen, dass Friedrich II. von Preußen und die
Vereinigten Staaten von Amerika 1785 einen Freundschafts- und
Handelsvertrag schlossen, der nicht nur die Anerkennung der USA durch
Preußen dokumentierte, sondern auch der weltweit erste Staatsvertrag war,
der in Friedenszeiten die Bedingungen der Kriegsgefangenschaft regelte.
Dieser Vertrag, den Friedrich schon 1783 nach Gründung der Vereinigten
Staaten ansteuerte, endete erst 1917 mit dem Eintritt der USA in den
Ersten Weltkrieg. In der DDR gehörten übrigens Friedrich der Große, Martin
Luther (1483–1546) und der berühmte Schriftsteller Karl May (1842–1912) zu
den »Unpersonen«. Erst Ende der 70er Jahre begann sich dort die offizielle
Kulturpolitik dem bürgerlich-fortschrittlichen kulturellen Erbe zu öffnen
und die Beschäftigung damit zu fördern, ja zu fordern, und davon
profitierten neben anderen bislang verpönten Schriftstellern alle drei.
Dass Friedrich der Große auch im Werk Karl Mays vorkommt, ist nicht weiter
verwunderlich in Anbetracht der Veehrung, die der Alte Fritz im 19.
Jahrhundert genoss. In seiner Erzählung Pandur und Grenadier von
1883 steht Friedrich mit seinem Feldmarschall, dem Alten Dessauer, 1742 in
Böhmen; er »war von nicht hoher, schmächtiger Gestalt und trug anstatt der
Reitpeitsche einen hölzernen Krückstock in der Rechten«; und in der
humoristischen Episode aus dem Leben des Alten Dessauers Unter den
Werbern von 1876, die später noch mehrfach erschien, lästert der
Alte Dessauer über Friedrich, er spiele nur Flöte, merke aber nichts von
der allmählich zunehmenden Gefahr durch Sachsen. Später gibt Friedrich
dann dem Dessauer Befehl, zum Krieg gegen Sachsen zu rüsten. Der Alte
Dessauer ist übrigens eine historische Gestalt: Der preußische
Feldmarschall Fürst Leopold I. von Anhalt-Dessau (1676–1747), der im
preußischen Heer den Gleichschritt und eiserne Ladestöcke einführte,
zeichnete sich im Spanischen Erbfolgekrieg, im Nordischen Krieg und dann
im Zweiten Schlesischen Krieg unter Friedrich dem Großen aus.

Friedrich der Große (Gemälde von Anton Graff,
1781, Wikipedia)
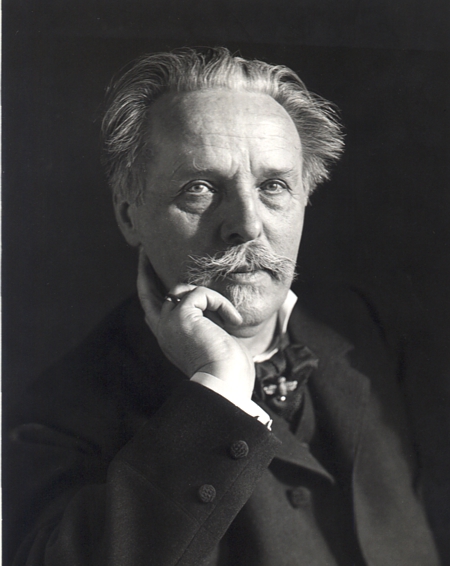
Karl May (1906, Karl-May-Stiftung Radebeul)
Dass in unserem Kontext May erwähnt wurde, hängt an Friedrichs Beziehung
zu den Vereinigten Staaten. Diese wirft ebenfalls ein Licht auf die
Widersprüchlichkeit des Königs, wie wir sie auch schon bei Ludwig und
Peter sowie bei Katharina der Großen vorgefunden haben. Wie bei May haben
Dichtungen um und über Friedrich vor allem Anekdotisches benutzt. Das
zeigt sich zum Beispiel in zahlreichen französischen Werken, beginnend mit
dem Abenteuerroman Les barons de Felsheim von Pigault-Lebrun
(1798/99). Die Novelle Friedrich der Große bei Kolin
veröffentlichte K. Bleibtreu 1888. Viele Dramen (z.B. Katte von H. Burte
1914 oder Vater und Sohn von J. von der Goltz 1921), ein Roman (Der
Vater von J. Klepper 1937) und nur ein Lustspiel (Zopf und
Schwert von K. Gutzmann 1844) behandelten das schwierige Verhältnis
Friedrichs des Großen zu seinem Vater, und Heinrich Mann hinterließ ein
Romanfragment Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen,
die 1960 veröffentlicht wurde. Aus England kamen so gegensätzliche
Schriften wie das sechsbändige Werk des einflussreichen Historikers und
Sozialkritikers Thomas Carlyle (1795–1881) History of Friedrich II of
Prussia, called Frederick the Great von 1858 bis 1865, in dem
Friedrich über Gebühr gepriesen und glorifiziert wird, und dem des
Essayisten, Dichters, Historikers und Staatsmannes Tomas B. Macaulay
(1800–1859) Frederick the Great von 1842, in dem kein gutes Haar
an ihm gelassen wurde: Friedrich der Große als grausamer und brutaler
Kriegstreiber. Als 1806 Napoleon an Friedrichs des Großen Sarg stand –
Preußen lag nach den Siegen Napoleons darnieder – sagte er zu seiner
Begleitung, auch ein Satz, der sich in der Erinnerung erhalten hat: »Wenn
der noch lebte, dann stünden wir nicht hier.« Seit dem Sieg von Roßbach
hieß Friedrich II. von Preußen endgültig der »große Friedrich«; schon
vorher, bei der Rückkehr aus dem Zweiten Schlesischen Krieg und seinem
Einzug in Berlin jubelte ihm das Volk als Friedrich dem Großen entgegen;
da war er gerade einmal 33 Jahre alt.
Preußen war als Herzogtum mit dem Vertrag vom 8. April 1525 zwischen Polen
und dem Deutschen Orden entstanden – der Ordensstaat wurde in ein
weltliches Herzogtum unter polnischer Lehnshoheit umgewandelt. Fast
hundert Jahre später, 1618, fiel es an die brandenburgische Linie der
Hohenzollern, die 1660 im Frieden von Oliva die Souveränität Preußens
erreichen konnten. Ab 1701 ging seine Geschichte im brandenburgischen
Gesamtstaat auf, der sich nun Preußen nannte. Das geschah, als sich der
Kurfürst von Brandenburg, wie erwähnt, zum König in Preußen krönte.
Brandenburg selbst hatte ebenfalls eine lange Geschichte hinter sich.
Ursprünglich siedelten hier germanische Völker wie die Semnonen,
Langobarden und Burgunder; im 7. Jahrhundert ließen sich dort, vor allem
im Osten, Slawen nieder. Um 940 kam das Gebiet unter deutsche Herrschaft,
schon 948 eentstand hier das Bistum Brandenburg, und das Gebiet wurde
christianisiert. 1134 wurde aus Brandenburg die Nordmark bzw. die Mark
Brandenburg; ihre Herren waren die Askanier, die das Land endgültig für
die deutsche Ausbreitung nach Osten erschlossen. Das Geschlecht der
Askanier, die erst Markgrafen, seit 1177 Reichserzkämmerer und später
Kurfürsten wurden, starb Anfang des 14. Jahrhunderts aus; nun – 1320 –
fiel Brandenburg vorübergehend an die Wittelsbacher, 1373 an die
Luxemburger, und 1411/15 an das Haus Hohenzollern, das 1417 auch die
Kurwürde verliehen erhielt. Im Verlauf der Jahrhunderte wurde Brandenburg
gebietsmäßig beträchtlich erweitert, abgesehen davon, dass Berlin zur
Hauptstadt erkoren und die Reformation eingeführt wurden; hinzu kamen das
Herzogtum Kleve, die Grafschaften Mark und Ravensberg, Hinterpommern und
1618, wie gesagt, Preußen, das 1660 aus der Lehnshoheit Polens entlassen
wurde. Es war dann dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm (geb. 1620; reg.
1640–1688) vorbehalten, in dem Gebiet einen absolutistisch-preußischen
Staat zu schaffen, mit dem Ziel eines kalvinistischen Modellstaates vor
Augen. Ihn nannte man nicht von ungefähr den »Großen Kurfürsten«.
Besonders mit seinem Edikt von Potsdam von 1685, mit dem Hugenotten,
später auch anderen Glaubensflüchtlingen und Auswanderern die Ansiedlung
in Brandenburg gestattet wurde, hob sich der Große Kurfürst von seinen
Zeitgenossen unter den Fürsten ab. Ansonsten war durchaus Frankreich sein
politisches und kulturelles Vorbild. Im Westfälischen Frieden erzielte er
große Gebietsgewinne, sein im Dreißigjährigen Krieg verwüstetes Land baute
er mit einer einheitlichen und herausragenden Verwaltung wieder auf, und
mit Groß-Friedrichsburg im heutigen Ghana errang er 1683 sogar kolonialen
Besitz, der allerdings schon 1717 an die Niederländer verkauft wurde. Ab
1686 wechselte der Große Kurfürst vom französischen Bündnis hin zu den
Habsburgern. Mit dem Ausbau seines Heeres und seinen sonstigen Maßnahmen
legte er den Grundstock für den rasanten Aufstieg Preußens. Als sich dann
noch, wie erwähnt, sein Sohn, der Kurfürst von Brandenburg Friedrich III.
zum König krönte – er wurde damit zu Friedrich I. (geb. 1657; reg. 1688
als Kurfürst/ 1701 als König bis 1713) spricht man nur noch von Preußen,
auch wenn Friedrich nur König in Preußen war; ab 1772 nannten sich die
Herrscher mit Friedrich dem Großen Könige von Preußen.
Friedrich der Große kam am 24. Januar 1712 in
Berlin zur Welt. Sein Vater war der bereits erwähnte Kurfürst und König
Friedrich Wilhelm I., der wegen der starken Armee, die er aufbaute,
»Soldatenkönig« genannt wurde. Er vollendete in Preußen die absolute
Monarchie. Der Konflikt zwischen ihm und seinem Sohn blieb bis in unsere
Zeiten bekannt.
Friedrich der Große kann mit Fug und Recht in
drei oder vier Charaktere mit den dazu gehörigen Leistungen aufgespalten
werden; drei davon, jeder für sich, hätte schon genügt, Friedrich zum
»Großen« zu machen.
Da war zunächst der Schöngeist, der intellektuelle und aufgeklärte,
musisch begabte Friedrich. Sein Vater hielt einen einfachen,
bürgerlich-pietistischen, sittenstrengen, von Plichterfüllung geprägten
Hof. Er ließ Friedrich streng militärisch erziehen, so dass er es 1730
nicht mehr aushielt und einen Fluchtversuch nach England unternahm. Der
Hinrichtung seines Freundes Katte, der an der Flucht beteiligt war, musste
er gezwungenermaßen zusehen; er selbst blieb in Haft in Küstrin, bis er
sich im Februar 1732 ebenfalls gezwungenermaßen verloben musste. Er
unterwarf sich nun seinem Vater; wie weit er Verständnis für dessen
Staatsführung aufbrachte oder wie weit er alles nur noch hinnahm, wird
sich letztlich nie klären lassen. Jedenfalls lebte er nun im Schloss
Rheinberg relativ sorglos, umgab sich mit Freunden, verfasste hier den
berühmten Antimachiavell (1739), in dem er den aufgeklärten
Absolutismus beschrieb: der Herrscher als erster Diener des Staates,
dessen Souveränität zwar unbeschränkt, der aber der Wohlfahrt des Volkes
verpflichtet ist. Von Gottesgnadentum war keine Rede mehr; ganz im
Gegenteil verdanke der Herrscher seine Position dem Zufall der Geburt.
Direkt nach seinem Regierungsantritt 1740 lud Friedrich Voltaire und
andere bedeutende Vertreter der französischen Aufklärung in die Preußische
Akademie der Wissenschaften ein, wo er ihnen eine Wirkungsstätte für ihre
Ideen gab; Voltaire hielt sich wiederholt dort auf, sogar bei einer
Gelegenheit mehrere Jahre, bis sich das Verhältnis zu dem König abkühlte.
Zeit seines Lebens war Friedrich der französischen Kultur und Literatur
eng verbunden. Im Gegensatz zur deutschen Literatur hing er an der
deutschen Musik, z. B. an der der Bachs; er selbst war ein begeisternder
Flötenspieler und Komponist – vier Flötenkonzerte und 121 Flötensonaten
und einige Märsche gehen auf ihn zurück. Er förderte die bildende Kunst –
der neue Dom in Berlin, das dortige Opernhaus und das Rokokoschloss
Sanssouci entstanden –, und auch als militärisch-politischer
Schriftsteller wirkte Friedrich in herausragendem Maße.
Der andere Friedrich war der kriegerische. Dieser
Teil seines Charakters stand im Widerspruch zu seinen Vernunft- und
Humanitätsideen. In den Schlesischen Kriegen 1740–42 und 1744/45
annektierte er das habsburgische Schlesien. In Schlesien hatten die
Skythen gelebt, die Kelten, danach die Wandalen und nach deren Abzug seit
dem 6. Jahrhundert Slawen. Seit dem Ende des 10. Jahrhunderts gehörte es
zu Polen. Im 13. Jahrhundert warben die polnischen Herzöge zahlreiche
deutsche Siedler an, die Schlesien deutsch prägten. Im 14. Jahrhundert
unterstellten sich alle oberschlesischen und die meisten
niederschlesischen Herzöge der Lehnshoheit Böhmens, womit das Gebiet
mittelbar zum Heiligen Römischen Reich kam. Dieser Schritt wurde 1348
endgültig durch den späteren Kaiser Karl IV. vollzogen, nachdem Polen 1335
auf seine Ansprüche auf Schlesien verzichtet hatte. 1526 kam dann
Schlesien mit Böhmen an die Habsburger. Nun hatte einer der vielen
polnischen Herzöge in Schlesien, der Liegnitzer Spross der Piasten, 1537
Erbverträge mit den Hohenzollern geschlossen. Auf diese berief sich
Friedrich, als er das Land an sich riss. Schlesien war wegen seines
Bergbaus und seiner Textilherstellung damals eines der wichtigsten
Ländereien der Habsburger. In Österreich regierte seit 1740 Maria Theresia
(1717–1780), die hin und wieder die »große Kaiserin« genannt wird und die
sicher zu den bedeutendsten Herrscherinnen der Geschichte zu zählen ist.
Der Verlust Schlesien traf sie hart. Da Friedrich überzeugt war, dass die
Konkurrenz mit Österreich auf Dauer wieder zum Krieg führen würde, begann
er 1756 den Siebenjährigen Kreig durch einen »Präventivschlag« gegen
Kursachsen. War Friedrich bei der ersten Schlacht im 1. Schlesischen Krieg
noch geflohen, erwies er sich seitdem als hervorragender Feldherr und
Führer seiner 180.000 Mann starken Armee; man kann ihn getrost zu den
größten Feldhern der Geschichte rechnen. Dennoch wäre die Katastrophe wohl
unausweichlich gewesen, wenn nicht, wie erwähnt, Russland unter Peter III.
mit ihm Frieden geschlossen hätte. Am Ende des Krieges 1763 wurde für
Preußen nicht nur der Besuitzstand wie vor dem Krieg, einschließlich
Schlesiens bestätigt, nein, Preußen war auch europäische Großmacht
geworden, und Friedrich war eine legendäre Gestalt. – Durch die 1.
polnische Teilung und durch Erbfälle erhielt Preußen weitere Gebiete.
Der dritte Friedrich der Große war der Reformer
und Verwalter, der den inneren Ausbau Preußens vorantrieb. Er schaffte die
Folter ab, auch wenn er sie in Einzelfällen noch zuließ; die Gerechtigkeit
in seinem Staat wurde vorbildlich, auch wenn sie in Einzelfällen noch
Schaden nahm Aber, so schrieb er: »In den Gerichtshöfen müssen die Gesetze
sprechen, und der Souverän muß schweigen [...] die Justizkollegia sollen
bedenken, daß der geringste Bauer ebenso gut ein Mensch ist wie Se.
Majestät, indem vor der Justiz alle Leute gleich sind.« Das Prozesswesen
wurde reformiert (1747); ein Allgemeines Landrecht ausgearbeitet, das 1794
verabschiedet wurde; die Verwaltung ausgebaut. Friedrich überantwortete
jedem Stand bestimmte Aufgaben. So stellte der Adel die Offiziere und
höheren Beamten, während die Bürger Handel und Gewerbe betreiben sollten.
Auf diese Weise stärkte Friedrich die ständische Ordnung. Die Regierung
führte er persönlich mit Hilfe von Kabinettsräten, aber Fachdepartements
untersützten seine Arbeit, wenn auch zentralistisch geordnet. Seine
volkswirtschaftlichen Maßnahmen, zu denen eine strikte Steuerpolitk und
ein rigoroser Merkantilismus gehörten, führten zur Hebung der
Staatseinnahmen. Seinem Nachfolger hinterließ Friedrich ein hinsichtlich
der Größe verdoppeltes Preußen und ein Staatsvermögen von 70.000.000
Talern, von der Armee von 200.000 Mann gar nicht zu reden. Er förderte
auch die Landwirtschaft, sowohl die bäuerliche als auch die adlige,
siedelte 57.000 Familien an und entwickelte die neu hinzu gekommenen
polnischen Gebiete (Westpreußen) durch Meliorationen und Kanalbauten. Dazu
kamen noch bildungspolitische Maßnahmen wie das Landschulreglement 1763,
verbesserte Lehrerbildung und Volksschulwesen und vieles mehr. Das Los der
leibeigenen Bauern besserte er, ohne sich dazu entschließen zu können, die
Leibeigenschaft ganz abzuschaffen.
Nun gab es natürlich auch noch einen privaten
Friedrich. Er heiratete 1733 Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern
(1715–1797), d. h. musste sie heiraten und wurde auch von den Habsburgern
mit einer Jahrespension von 2500 Dukaten dazu »überredet«; schließlich war
sie die Nichte von Kaiser Karl VI. (geb. 1685; 1711 (König, Kaiser)–1740).
Aber was sich die Habsburger davon versprachen, nämlich ein gutes
Verhältnis zu ihm, erreichten sie nicht. Mit seinem Regierungsantritt
lebte das Ehepaar getrennt. Kinder gingen aus der Ehe nicht hervor. Da
sich Friedrich viel mit Männern umgab, z. B. seine berühmte »Tafelrunde«
aus ausgewählten Denkern und Schriftstellern, kam das Gerücht auf, er
leide an einer Geschlechtskrankheit oder sei gar homosexuell. Dass
fürstliche Ehepartner nicht zusammen passten, war in der Geschichte nichts
Neues. Und Friedrich soll auch ab 1743 eine Liaison mit der italienischen
Tänzerin Barberina Campanini gehabt haben, die als einzige Frau Schloss
Sanssouci betreten durfte. Dennoch war er, vor allem in seinen letzten
Lebenjahren, einsam und verbittert. Aus dem Siebenjährigen Krieg war er
krank zurückgekehrt. Am Ende seines Lebens wurde er starrer, schroffer,
zynisch und skeptisch, was seine Mitmenschen und die Politik anging. Aber
er wurde unglaublich volkstümlich, weil er dem Volk den Glauben und auch
das Vertrauen vermittelte, er kümmere sich um alles persönlich, auch wenn
man ihm unterstellte, er verachte die Religion und die Kirche. Tatsächlich
glaubte er an ein Höchstes Geistiges Wesen, das die Welt geschaffen, aber
dann sich selbst überlassen habe. Darin glich er Voltaire. Als er am 16.
August 1786 starb, soll ein schwäbischer Bauer ausgerufen haben: »Wer soll
nun die Welt regieren?«
Friedrich stand immer in der Spannung zwischen seinen humanitären und
idealistischen Zielen einerseits und der Staatsräson andererseits, wozu
auch seine Kriege zu zählen sind. In der Geschichte hat man ihn sehr
unterschiedlich beurteilt, je nach historischem Kontext und politischer
Perspektive. Macaulays Anklage hat man in eine Anklage gegen den deutschen
Geist bis hin zu den Weltkriegen schlechthin umgemünzt; die Bewunderung
eines Carlyle für ihn findet sich ähnlich in einer glorifizierten
Heldenverehrung durch andere. Sein Deutscher Fürstenbund wird als
bedeutsamer Schritt zur Vereinigung der deutschen Staaten angesehen – von
den einen; andere meinen, er habe 1785 den letzten Versuch einer deutschen
Verfassungsreform im Fürstenbund vereitelt. Man wird seine Persönlichkeit
in ihrer Gesamtheit nie zu fassen bekommen – er war eben Friedrich der
Große.
Sein Vermächtnis blieb. Zwar lag Preußen in den Napoleonischen Kriegen
darnieder, aber danach erholte es sich. Ob die spätere Entwicklung
Preußens bis hin zur Gründung des Deutschen Reiches und der Weimarer
Republik mit ihren Höhen und Tiefen, ihren Kriegen und ihren Bündnis- und
Friedensbemühungen der deutschen Geschichte mehr genutzt oder geschadet
hat, wird sich vielleicht in hundert Jahren beantworten lassen, wenn
überhaupt ...
3. Ausklang im Fernen und Nahen Osten
In der Neuzeit sind uns bereits einige nicht europäische Fürsten begegnet,
die den Titel »der Große« erhielten. Sie, speziell Akbar und Abbas, waren
die bekanntesten – und sie trugen den Titel mit Recht – aber nicht die
einzigen. Interessanterweise finden sich die letzten in unserer »Kleinen
Weltgeschichte der ›Großen‹«, die diese Bezeichnung erhielten, nicht in
Europa, sondern in Amerika, Afrika bzw. Asien.
Erneuerer und Gründer von Reichen: Pakal, Radama, Taksin,
Kamehameha und Bechir die Großen
Wir müssen in der Zeit noch einmal weit zurückgehen. Was niemand vermuten
würde: Im alten Maya-Reich in Mittelamerika gab es tatsächlich auch einen
›Großen‹. Seine unversehrte Totengruft und der noch verschlossene Sarg
wurden – es war ein großer Glücksfall – von einem mexikanischen Ausgräber
aufgefunden. Den König bedeckte eine Jade-Mosaik-Maske, und er war mit
reichem Schmuck begraben. Auf der Oberseite des Sargdeckels fand sich die
Apotheose des Königs, und eine Inschrift entlang der Kanten informierte
über die Daten seiner Vorfahren und sein eigenes Leben. Es handelte sich
um Pakal den Großen (603–683), der schon mit knapp dreizehn Jahren 615 zur
Herrschaft gelangte. Seine Mutter Säk-K’uk‘ (gest. 640) hatte vorher, seit
612, die Regentschaft geleitet; ihr Mann K’än-Bahläm-Mo‘ (gest. 642), also
der Vater Pakals, hatte im Hintergrund gestanden, eine für die
Maya-Verhältnisse mit ihrem patrilinearen Verwandtschaftssystem
ungewöhnliche Situation; solche Herrschaftsverhältnisse mit der Prominenz
von Frauen gab es aber auch anderswo bei den Maya. Die Mutter Pakals zog
sich mit der Inthronisation von Pakal zurück, und Pakal der Große wurde
der hervorragendste Herrscher der Maya-Stadt Palenque, der sich um den
Frieden mit anderen Maya-Herrschern bemühte und als Förderer der Baukunst
hervortrat. Er heiratete Ahpo-Hel (650–672), die ihm zwei Söhne gebar –
beide wurden später bedeutende Herrscher in Palenque.«
Machen wir nun einen großen Zeit- und Erdteilsprung: Die viertgrößte Insel
der Erde ist Madagaskar; sie wurde einerseits von Afrika aus besiedelt,
von der anderen Seite her von Südasien. Dadurch bildete sich ein Mischvolk
mit 18 Hauptethnien (Foko), von afrikanisch mit arabischen Einsprengseln
bis zu überwiegend indonesisch. Im 17. Jahrhundert ließen sich Franzosen
an der Ostküste nieder und beanspruchten daraufhin die Insel für sich.
Ende des 18. Jahrhunderts gab es auf Madagaskar vier Königreiche, die
unter einem starken Machthaber, Nampoina (gest. 1810), zusammengeführt
wurden. Echten Glanz erhielt das Reich aber erst unter seinem Erben Radama
I. (ca. 1793–1828), der den Titel ›der Große‹ zugesprochen bekam (Daniel
Zander). Dieser junge, gut aussehende, vitale Herrscher, voller Tatendrang
und von seinem Volk vergöttert, der Napoleon als Vorbild ansah, eroberte –
gemäß seinem Grundsatz: »Das Meer ist meines Reisfeldes einzige Grenze« –
einen Großteil der Insel, führte aber auch ausgewählte europäische
Techniken ein. Er warf die Franzosen aus dem Land und setzte auf die
englische Karte. Im Vertrag von 1817 erhielt er nicht nur den Titel ›König
von Madagaskar‹, sondern auch gewaltige Zugeständnisse der Briten
hinsichtlich ihrer Lieferungen – jährlich 1000 Golddollar, 1000
Silberdollar, hundert Pulverfässer, hundert Gewehre und Uniformen – an
ihn. Radama seinerseits stellte auf Wunsch der Engländer den Sklavenhandel
ein, beendete das Piratenunwesen an der Westküste und öffnete das Land
europäischem Einfluss. Mit Hilfe der London Missionary Society gründete er
Schulen, die auch Mädchen offenstanden. Er ließ eine madagassische
Schriftsprache entwickeln – mit lateinischer Schrift als Grundlage – und
Schmiede, Maurer, Weber, Gerber, Spinner und sogar Seidenraupenzüchter
ausbilden. Sein aufreibendes Leben, aber auch seine Ausschweifungen wie
seine Alkohol- und Sexeskapaden führten zu seinem frühen Tod. Es wird
berichtet, dass sich bei seiner Heirat 200.000 Menschen vor seinem Palast
in einer riesigen Massenorgie liebten. Seine älteste Frau Ranavalova
(gest. 1861), die sich nach seinem Tod auf den Thron setzte, versuchte,
das Rad der Geschichte unheilvoll zurückzudrehen. Über 200.000 Menschen –
20 bis 40 Prozent der Bevölkerung – kamen dabei ums Leben, die Christen
wurden verfolgt, vertrieben oder umgebracht, und der Wohlstand des Landes,
den Radama der Große geschaffen hatte, ging dabei zugrunde.
class="auto-style4">Machen wir nun einen Sprung nach
Asien. In Zentral-Thailand gab es im 1. Jahrtausend n. Chr. ein
buddhistisches Königreich, es hieß Dvaravati und wurde vom Volk der Mon
gegründet. Auch die hinduistischen Khmer von Angkor beherrschten damals
Teile des heutigen Thailand. Sie wurden aber im 13. Jahrhundert von den im
Norden ansässigen Thai vertrieben, die sich im 11. und 12. Jahrhundert
unter den Mon niedergelassen und mit ihnen vermischt hatten. Um 1240
gründeten sie das Reich der Sukhothai, das seinen Machtbereich erheblich
erweiterte – im Süden reichte es bis zur Halbinsel Malakka. Dieses Reich
wurde im 14. Jahrhundert durch das von Ayutthaya abgelöst, zu dem auch die
südlichen Thai-Fürstentümer und Kambodscha gehörten. Ayutthaya wiederum
wurde 1569 zum Vasallenstaat von Birma, nur um fünfzehn Jahre später neu
zu erstehen und noch um Gebiete der Khmer und andere vergrößert zu werden.
Später betraten die Franzosen die Bildfläche; mit ihnen wurde 1686 ein
Vertrag geschlossen, der es ihnen, zumindest zeitweilig, erlaubte,
Handelsniederlassungen zu bauen, Missionstätigkeit zu betreiben und
Truppen in der Hauptstadt zu stationieren. 1767 wiederum fielen erneut die
Birmanen ein, belagerten die Hauptstadt ein Jahr lang und zerstörten
schließlich Ayutthaya, die Stadt wie das Reich; der damalige König kam in
den Flammen ums Leben. Allerdings begingen die Birmanen den Fehler, nur
geringe Besatzungen im eroberten Land zurück zu lassen; zu sicher waren
sie sich ihrer Beute. Einige fähige siamesische Statthalter und Anführer
waren den Birmanen entkommen und organisierten den Widerstand; einer von
denen, die übrig geblieben waren, mit Namen Phaya Tak, sammelte alle
waffenfähigen Männer um sich, die er vorfand – häufig handelte es sich um
versprengte Krieger – und schlug mit ihnen die Birmanen, die durch
chinesische Angriffe geschwächt waren, entscheidend und warf sie zurück.
Sein Name ist auch als Phraya Taksin überliefert, und er war nicht nur ein
fähiger, sondern auch ein beliebter Heerführer. Geboren am 17. April 1734
in Ayutthaya, war er der Sohn eines wohlhabenden chinesischen
Einwanderers, der in der Hauptstadt Spielhallen betrieb, und einer
Thailänderin (Siamesin). Sin, wie sein Name ursprünglich lautete, in
seiner Jugend buddhistischer Mönch, machte eine öffentliche Karriere,
wurde Gouverneur der Provinz Tak, daher der Name Taksin, und später
General im Heer des Königs. Nach dem Sieg über die Birmanen gründete er
1768 eine neue Hauptstadt, Thonburi, gegenüber dem heutigen Bangkok, auf
der rechten Seite des Stromes Menam Chao Phraya oberhalb seiner Mündung.
In seiner fünfzehnjährigen Regierungszeit führte er das ehemalige
Königreich von Ayutthaya beinahe wieder zu seiner alten Blüte. Er eroberte
Kambodscha und kleinere Staaten im Süden, besiegte 1777 dann im Norden die
Lao und schlug erneut die Birmanen. Als König trug er den Namen Boroma
Radscha IV. Gestützt und anerkannt von China, mit dem Thailand bald
wichtige Handelsbeziehungen verband, schaffte er auch im Inneren des nach
dem Zusammenbruch des Ayutthaya-Reiches in Anarchie und Chaos versunkenen
Landes wieder Ordnung. Natürlich erwuchsen ihm dadurch auch viele Feinde.
Im Lauf der Jahre wurde er bei seinen Maßnahmen immer grausamer; offenbar
fiel er mit der Zeit in geistige Umnachtung. Schließlich wurde er durch
eine Rebellion abgesetzt und in ein Kloster verbannt. Man holte ihn aber
wieder heraus, machte ihm den Prozess und richtete ihn am 6. April 1782
hin; da königliches Blut nicht vergossen werden durfte, wurde er in einem
Samtsack mit einem Sandelholzknüppel zu Tode geprügelt. Sein Nachfolger
wurde der Begründer der Chakri-Dynastie, Chao Phraya Chakri, der als Rama
I. (König Puttha Yotfa Chulalok) den Thron bestieg. Die Chakri-Dynastie
ist in Thailand noch heute an der Macht.
Da sich Taksin, wie man bald nach seiner
Hinrichtung anerkannte, durchaus viele Verdienste um Thailand erworben
hatte, wurde er zwei Jahre nach seinem Tode doch noch in Ehren beigesetzt,
und am 27. Oktober 1981 wurde ihm vom thailändischen Kabinett sogar
posthum der Titel »der Große« (Maharat) verliehen; der 28. Dezember, sein
Krönungstag, wurde zum nationalen Gedenktag, wenn auch nicht zum
offiziellen Feiertag erhoben. Rama I. (1782–1809) verlegte die Hauptstadt
auf die andere Stromseite nach Bangkok. Damals waren die Franzosen in
Thailand schon sehr einflussreich, aber Rama I. und seine Nachfolger
betrieben eine kluge Außen- und Handelspolitik, schlossen mit den
europäischen Mächten und den USA Verträge, so mit Großbritannien 1855
einen Freundschaftsvertrag, und auf diese Weise bewahrte Thailand als
einziges Land in Südostasien seine staatliche Unabhängigkeit. König Rama
V. (1868–1910) modernisierte dann das Land im westlichen Sinne. Taksin der
Große ist unvergessen; an ihn erinnern heutzutage Statuen in Thailand und
der nach ihm benannte Nationalpark Taksin Maharat in der Provinz Tak.
Unsere weitere Reise in den Fernen Osten bringt uns nun nach Hawaii im
zentralen Nord-Pazifik, einem herrlichen, durch zahlreiche, teilweise noch
aktive Vulkane und eine bizarre Vulkanlandschaft geprägten Archipel. Aus
acht Hauptinseln und etwa 120 kleinen Nebeninseln bestehend, weist Hawaii
ein mildes und ausgeglichenes Klima auf, das durch den Nordost-Passat
geprägt ist. Die einladende Insellandschaft zog schon um 800 n. Chr.
Polynesier, wahrscheinlich überwiegend aus Samoa kommend, an, die sich
hier niederließen. 67 Ahnen schrieb sich der so bedeutende Herrscher
Kamehameha, auf den wir gleich zurückkommen, zu, was den Beginn der
Besiedlung Hawaiis sogar schon in das 6. Jahrhundert n. Chr. vorverlegen
würde. Der berühmte britische Seefahrer James Cook (1728–1779) entdeckte
die Inseln 1778 und nannte sie Sandwich-Inseln; er wurde hier ein Jahr
später von Eingeborenen erschlagen. Als er auf Hawaii landete, traf er auf
drei Staaten: Hawaii, Maui und Oahu; da allerdings der Herrscher von
Hawaii die Königinwitwe von Maui zur Ehefrau genommen hatte, wurden beide
Staaten von nur einem Oberhaupt regiert. Zwischen Hawaii und Oahu gab es
ständige kriegerische Auseinandersetzungen, und auch innere Kämpfe
zermürbten die Staaten. Nur wenige Jahre später gelang es dann einem
einheimischen Führer, alle Inseln unter seiner Herrschaft zu vereinen und
Ordnung zu schaffen. Dabei handelte es sich um den eben erwähnten
Kamehameha, der erste von fünf Herrschern dieses Namens, und Kamehameha
wurde zudem Nui genannt: »der Große«. Sein Geburtsjahr ist unbekannt. Die
einen geben 1737 an, die anderen 1758, aber genau weiß es keiner. Für das
Jahr 1758 spricht die Legende, dass die Geburt eines Herrschers, der ganz
Hawaii vereinigen würde, im Zeichen eines Kometen erfolgen würde, und 1758
trat tatsächlich ein Komet in Erscheinung, nämlich der Halleysche Komet,
und war von Hawaii aus zu sehen. Schon als junger Mann zeichnete sich
Kamehameha als Krieger aus, er nahm als Wächter des Kriegsgottes auch eine
hohe religiöse Stellung ein und wurde von manchen prophetischen Dichtern
schon damals als der künftige Einiger gesehen und besungen. Als er zwei
Jahre nach Cooks Tod Häuptling wurde, machte er seinen Traum von der
Einheit des Archipels wahr, eroberte alle Inseln bis auf Kauai und Niihau,
die sich ihm später, 1810, freiwillig unterwarfen und an ihn verkauft
wurden, und konnte sich 1795 zum alleinigen Herrscher Hawaiis, zum König,
proklamieren lassen. Mit großer persönlicher Tapferkeit ausgestattet,
unterstützt durch eine Streitmacht, die von in Diensten genommenen
Europäern geschult war und auch über Feuerwaffen verfügte, war er mit
16.000 Mann nach Oahu übergesetzt und hatte die Schanze Pali erstürmt. Zu
seinen Streitkräften gehörte seit 1804 sogar noch eine Flotte von 21
Schiffen von 25 bis 50 Tonnen. Nachdem er seine Pläne verwirklicht hatte,
organisierte er eine hervorragende Verwaltung, vereinheitlichte das
Rechtssystem und regierte friedlich bis zu seinem Tode am 8. Mai 1819. Der
englische Entdecker und Forscher Kapitän George Vancouver (1758–1798), der
1793 nach Hawaii kam, schrieb über ihn: »Seine Haltung war majestätisch;
jede seiner Handlungen offenbarte einen Geist, der seinen Besitzer in
jeder Lage herausgehoben hätte […] Sein allgemeines Verhalten war offen,
großzügig und freundlich. In Erscheinung und Haltung ein wilder Herkules,
in Fähigkeiten und Charakter ein Mann, den jedes Land stolz als seinen
Sohn anerkannt hätte.« Und ein Historiker urteilte Anfang des 20.
Jahrhunderts über Kamehameha den Großen: Er »muss eine machtvolle
Persönlichkeit gewesen sein […] Er war nicht nur an Verstandeskräften groß
und durch ein majestätisches Äußeres ausgezeichnet, größer war er noch
durch seine sittliche Kraft sowie durch die Macht und Reinheit seines
Willens […]«; er war ein Mann, »der an äußeren Erfolgen wie an Gaben des
Geistes über das Durchschnittsmaß seiner Rasse weit hinausragt.« Der
deutsche Dichter Adalbert von Chamisso (1781 – 1838), der Dichter des
»Peter Schlemihl«, des »Mannes ohne Schatten«, nahm an der zweiten
russischen Weltumseglung teil, die von 1815 bis 1818 unter dem
baltendeutschen Kapitän Otto von Kotzebue (1787–1846), Sohn des
Dramatikers August von Kotzebue (1761–1819 (ermordet)), stattfand. Er
äußerte sich stolz darüber, dass er – außer dem französischen Helden aus
dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und Staatsmann Joseph de Motier,
Marquis de La Fayette (1757–1834) und dem britischen Entdecker und
Naturforscher Sir Joseph Banks (1743–1820) – auch Kamehameha dem Großen
die Hand drücken durfte. Aber Kamehamehas Regierung bedeutete nicht nur
Segen und Unabhängigkeit – seit 1817 fuhren seine Schiffe unter eigener
Flagge, der eines souveränen Staates – sondern auch den Beginn des
sozialen Abstiegs und Niedergangs seines Volkes. Er selbst blieb zwar den
alten Göttern treu, aber er öffnete Hawaii immer mehr für die Europäer und
europäische Güter. Um für deren Kauf die nötigen Gelder aufzubringen, ließ
er die wertvollen Sandelholzbestände von Hawaii abholzen und verkaufte sie
(die von ihm angeordnete Aufforstung führten seine Untertanen nicht aus),
führte rigorose Steuern ein und beutete sein Volk aus. Einerseits bewahrte
er durch den Handelsverkehr mit den Europäern und Amerikanern im Gegensatz
zu vielen anderen Inseln des Pazifischen Raumes die Unabhängigkeit seines
Reiches von den Kolonialmächten, aber andererseits machte er große
Schulden, um sich europäischen Luxus leisten zu können, und brachte so die
fremden Mächte mit der Zeit gegen sich auf. Verglichen damit, dass diese
Hawaii immer mehr als strategisch günstig gelegen und handelsmäßig und
wirtschaftlich als relevant anzusehen lernten, war die Frage von Schulden
allerdings zweitrangig. Während Kamehameha selbst die seinem Inselreich
drohenden Unwetter noch umschiffen konnte, gelang es seinen Nachfolgern
nicht mehr, ihnen auszuweichen. Die Amerikaner übten immer mehr Einfluss
aus. Als 1872 Kamehameha V., 42jährig, kinderlos starb, bedeutete dies das
Ende der Dynastie, und nur 15 Jahre später erbauten die Vereinigten
Staaten auf Hawaii den Marinestützpunkt Pearl Harbour, 1898 annektierten
sie den Archipel, der dann schließlich 1959 als 50. Bundesstaat offiziell
in die Vereinigten Staaten aufgenommen wurde. In der hawaiianischen
Hauptstadt Honolulu erinnert heute eine Statue an Kamehameha den Großen.
Das Ende unserer Reise durch die Geschichte der »Großen« führt uns nun
noch in den Nahen Osten, in den Libanon. Nach den Phönikiern, deren Reich
dort ihren Schwerpunkt hatte, kamen die Griechen und Römer, und ab 64 v.
Chr. gehörte der Libanon zur römischen Provinz Syria. Später waren die
Byzantiner hier die Herren, im 6. Jahrhundert die Perser, und seit dem 7.
Jahrhundert die Araber. Zunächst unterstand das Gebiet dem Kalifat, vom 9.
bis 11. Jahrhundert ägyptischen muslimischen Dynastien. Eine Zeit lang
herrschten dort auch die Kreuzfahrer, aber nach rund 200 Jahren eroberten
Ende des 13. Jahrhunderts die ägyptischen Mamelucken endgültig das Gebiet,
und seit 1516 waren die Osmanen die Herren im Libanon.
Aber unter ihnen genossen die hier ansässigen
feudalen Gemeinschaften der Drusen und Maroniten weit gehende
Selbstständigkeit. Die maronitische Kirche zählt zu den unierten
Ostkirchen des antiochenischen Ritus’, ja, sie ist die einzige vollständig
mit der katholischen Kirche unierte Ostkirche, und kann ihre Anfänge bis
ins 5. Jahrhundert zurückführen, auf das syrische Kloster des heiligen
Maro, der vor 423 starb. Um 745 wurde sie vom muslimischen Kalifat als
eigene Gemeinschaft anerkannt. Späteren Verfolgungen durch die Araber
versuchte sie sich durch die Abwanderung ihrer Mitglieder in den Libanon
zu entziehen. Während der Herrschaft der Kreuzfahrer, als die Maroniten
die Gemeinschaft mit der lateinischen Kirche suchten und aufnahmen, fand
ihr Oberhaupt formale Anerkennung als Patriarch von Antiochia durch den
Papst (1216). Die Drusen andererseits entstanden als Religionsgemeinschaft
erst im 11. Jahrhundert. Zwar gingen sie aus der islamisch-schiitischen
Richtung der Ismailiten hervor, aber da sie sich von der islamischen Lehre
fundamental abwandten, kann man sie nicht als islamische Sekte bezeichnen.
Sie vereinten in ihrer Lehre und Glaubenspraxis unterschiedliche religiöse
Traditionen, sie glauben u. a. an die Seelenwanderung, aber sind streng
monotheistisch. Früher wurden sie als eine religiöse Gemeinschaft mit
geheimer Lehre angesehen, weil ihre Heilige Schrift – nicht der Koran,
sondern ein Kanon aus 111 »Briefen der Weisheit« – als streng geheim galt
– inzwischen ist er allerdings der Wissenschaft bekannt, und eine
Konversion zum Drusentum ist nicht möglich, weil nach ihrem Glauben die
Seelenzahl der Drusen konstant ist. In der Geschichte des Libanon übten
die Maroniten und die Drusen, die ebenfalls vor den Arabern als »Verräter
am Glauben« fliehen mussten, die politische Macht aus und hielten sie in
einer gut ausgependelten Balance in Händen. Man hat sogar von einer
Symbiose, einer engen Interessenverflechtung der beiden Völker gesprochen,
die vom 13. bis zum 19. Jahrhundert friedlich und beinahe gleichberechtigt
in enger Nachbarschaft lebten, ohne sich zu vermischen, eine beinahe
einzigartige Schicksalsgemeinschaft. Von 1516 bis 1697 regierte bei den
Drusen die Maan-Dynastie, die bei den Osmanen sogar Verbesserungen für die
Maroniten erwirken konnte. Umgekehrt wurde der Libanon gerade durch die
Maroniten das Fenster zum Westen. Vor allem Frankreich übernahm die Rolle
einer Schutzmacht für die Christen im Libanon, aber der Sultan und der
französische König waren weit, die Praxis sah dann doch oft anders aus und
brachte für die Maroniten im eigenen Land Nachteile durch die Muslime. Im
18. Jahrhundert lief die Maan-Dynastie allmählich aus, und wieder einmal
taten sich Drusen und Maroniten zusammen und wählten gemeinsam die
Chehab-Dynastie für die Nachfolge. Diese war erst islamisch-sunnitisch,
dann drusisch und zuletzt maronitisch, was nicht ohne Widersprüche und
Krisen bleiben konnte. Von Anfang an bekriegten sich die in ihr mächtigen
Familien, die mit einander rivalisierten und konkurrierten. Einer ihrer
Fürsten wurde schließlich ermordet. Nun bestieg Bechir den Thron, 1788; er
regierte bis 1840, und man sagt von ihm, dass es ihm vor allem um seinen
eigenen Vorteil ging; nur dafür habe er zwischen den Parteien laviert, und
gerade nicht, um Frieden zwischen ihnen zu stiften. Die Drusen und
Christen sowie die europäischen Mächte und die osmanischen Herrscher
spielte er gegen einander aus; es kam am Ende, von Krieg, Mord und
Einmischung ausländischer Truppen ganz zu schweigen, zum Bruch der
Jahrhunderte alten Freundschaft zwischen Drusen und Christen. Aber Bechir
gilt nichts desto weniger als Bechir der Große, wie er im Werk von
Brissaud genannt wird. Die Massaker der Drusen an den Maroniten 1860, die
Zehntausende das Leben kosteten, brachten nicht nur das Eingreifen der
europäischen Mächte, vor allem Frankreichs, sondern auch die Einrichtung
des »autonomen Sandjaks Libanon« durch das Osmanische Reich 1861, der drei
Jahre später auf Betreiben Frankreichs einem christlichen Gouverneur
unterstellt wurde. Folgerichtig wurde der Libanon nach dem Ersten
Weltkrieg 1920 zusammen mit Syrien französisches Völkerbundmandat. Damit
waren aber die Bürgerkriege nicht beendet, und wer die Geschichte verfolgt
hat, weiß um die Zerstörung eines blühenden Staates, wie es der Libanon
gewesen war, im 20. Jahrhundert, auch das ein spätes und bitteres Erbe
Bechirs des Großen. Die heutzutage so traurigen Zustände im Nahen Osten
ihm anzulasten, ginge aber entschieden zu weit. Diese Verhältnisse warten
noch auf einen »Großen« der Geschichte, der die Probleme löst und der
ausgebluteten Region endlich den ersehnten Frieden bringt …
Epilog
Am 5. Mai 1987 erhielt ein lebender Monarch den Ehrentitel »der Große«,
allerdings nicht vom Volk oder der Völkergemeinschaft, sondern
zugesprochen vom Premierminister seines Landes. Kann man diesen dann als
»echten« Titel ansehen? Geehrt wurde damit der frühere König von
Thailand Rama IX. Wie auch vor ihm schon der thailändische König Taksin
den Beinamen durch Kabinettsbeschluss erhielt, war es nun eben der
Regierungschef, der den Titel sinnbildlich »überreichte«. König Bhumibol
Adulyadej wurde am 5. Dezember 1927 in Cambridge, Massachusetts,
geboren, wo sein Vater, Prinz Mahidol, an der Harvard Universität
Medizin studierte und einen akademischen Abschluss erreichte. Mahidol
starb schon kurz nach der Rückkehr nach Thailand 1928, und sein Bruder
Prajadhipok übernahm den Thron. Dieser war der letzte absolut regierende
König von Thailand. Bhumibol und sein älterer Bruder Ananda wurden zur
Ausbildung in die Schweiz gesandt. Als Prajadhipok 1935 abdankte, sollte
Ananda sein Nachfolger werden, aber beide Brüder blieben in Lausanne und
kehrten erst 1945 in ihre Heimat zurück. Am 9. Juni 1946 fand man Ananda
unter mysteriösen Umständen erschossen auf, und so wurde Bhumibol zum
Nachfolger erklärt. Er blieb allerdings nur zwei Monate in Thailand,
dann begab er sich abermals nach Lausanne, um Jura zu studieren. In
dieser Zeit führte ein Regentschaftsrat die Regierungsgeschäfte. 1950
kehrte Bhumibol endgültig heim; am 28. April heiratete er Prinzessin
Sirikit Kitiyakara, und am 5. Mai wurde er offiziell gekrönt. Bhumibol
entwickelte sich zum allgemein geachteten konstitutionellen Monarchen in
Thailand, beliebt und in hohem Ansehen beim Volk, dessen Wohl er sich
stets angelegen sein ließ – so nahm er eine bedeutende Rolle beim
Zusammenbruch des Militärregimes Kittikachorn 1973 ein –, und anerkannt
von der Staatengemeinschaft – zahlreiche Staatsoberhäupter kamen nach
Bangkok zu ihm zu Besuch, und umgekehrt reiste auch er viel ins Ausland.
Während seine Gemahlin in der galanten Welt berühmt wurde, ist Bhumibol
selbst als Komponist und Jazzmusiker in die Weltöffentlichkeit getreten.
Bhumibol starb am 13. Oktober 2016 nach langer Krankheit, hoch geehrt
und betrauert von seinem Volk.
Hier soll nicht die Frage erörtert werden, ob
Bhumibol den Titel »der Große« zurecht erhielt. Seit dem 18./19.
Jahrhundert ist der Titel in der Weltgeschichte nicht mehr häufig
vergeben worden. Es ist nicht mehr üblich, nicht mehr zeitgemäß.
Etwas anachronistisch mutete daher der Versuch
von Kaiser Wilhelm II. (geb. 1859; reg. 1888–1918; gest. 1941) an,
seinem von ihm sehr bewunderten Großvater, Kaiser Wilhelm I. (geb. 1797;
König von Preußen 1861; Kaiser 1871–1888), diesen Titel zu verschaffen.
Zur Feier anlässlich Wilhelms I. hundertjährigem Geburtstag am 22. März
1897 überall im Deutschen Reich gab er ihm wegen seiner Verdienste um
die Reichseinigung den Titel »der Große«. Der Beiname hat sich
allerdings nicht durchgesetzt. Von Bismarck, dessen Gönner Wilhelm I.
gewesen war, ist der Ausspruch überliefert, der Kaiser sei »kein Großer,
aber ein Ritter und ein Held« gewesen. Immerhin wurde der 1897 für die
Linienschifffahrt auf der Transatlantikpassage Bremerhaven – New York
fertiggestellte Doppelschraubendampfer des Norddeutschen Lloyd, der als
erstes deutsches Schiff das Blaue Band für die schnellste
Nordatlantiküberquerung erhielt (1897) und noch weitere Rekorde einfuhr,
auf den Namen ›Kaiser Wilhelm der Große‹ getauft. Und in der Nähe der
Stadt Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen im Kreis Minden-Lübbecke,
oberhalb des Weserdurchbruchs, am ›Tor nach Westfalen‹, hat man dem
Kaiser ein 88 m hohes Denkmal errichtet, das 1896 mit viel Pomp unter
Anwesenheit von Wilhelm II. eingeweiht wurde. Es ist schon von weitem zu
sehen und stellt einen Markstein in der Landschaft dar. Hier ist
eingemeißelt, dass es ›Wilhelm dem Großen‹ gewidmet sei.
Dieser Beiname ist nicht geblieben, aber dass Wilhelm I. allseits
Achtung genoss und zur Reichseinheit beitrug , wird man ihm nicht
absprechen können.
Andererseits – könnte man sich nicht trotzdem sogar für das 20. und 21.
Jahrhundert Persönlichkeiten vorstellen, die den Titel erhalten hätten,
wenn sie früher gelebt hätten? Man denke an Staatsoberhäupter,
Friedensnobelpreisträger, an Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi oder
Nelson Mandela, oder ...
Unsere kleine Weltgeschichte der »Großen« hat gezeigt, dass durchaus
viele, die diesen Titel erhielten, ihn mit Recht trugen und in ihrer
Zeit und für die Nachwelt ein Vorbild darzustellen vermochten. Auch
unsere Zeit hat ihre »Großen«; vielleicht sollte man sich an dem einen
oder anderen ein Beispiel nehmen und selbst aktiv werden, in Politik
oder Wissenschaft, oder sei es nur im »Kleinen«, in einem Ehrenamt oder
in der Unterstützung der eigenen Familie …