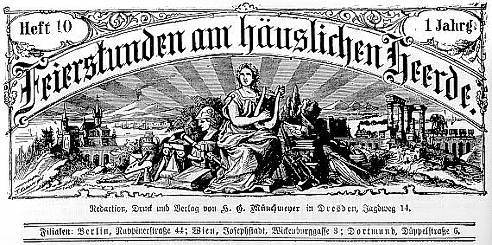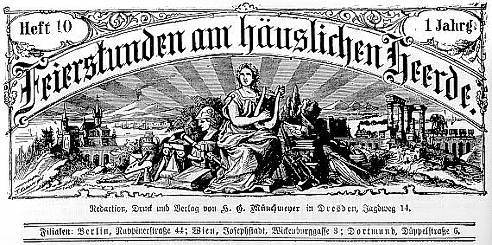|
Der
beiden Quitzows letzte Fahrten, ein historischer Roman aus der
Jugendzeit des Hauses Hohenzollern, erschien von November
1876 bis Juni 1877 im Unterhaltungsblatt ›Feierstunden am
häuslichen Heerde‹. Einige Monate zuvor, Anfang August 1876,
hatte May als Redakteur eine Fortsetzung zum Roman ›Fürst
und Junker‹ angekündigt, der von Friedrich Axmann verfasst
worden war:
»Denjenigen Lesern des ›deutschen Familienblattes‹, welche
sich mit den späteren Lebensschicksalen Dietrichs von
Quitzow bis zu seinem Tode bekannt zu machen wünschen,
dürfte die Nachricht nicht unwillkommen sein, daß der Autor
dieses Thema zum Gegenstande eines ebenso fesselnden, wie
ergreifenden Romans: ›Dietrichs von Quitzow letzte Fahrten‹
gewählt hat, welcher in Nummer 20 der diesjährigen
»Feierstunden am häuslichen Heerde«, einer im
Münchmeyerschen Verlage erscheinenden belletristischen
Zeitschrift, beginnen wird.« – (›Deutsches Familienblatt‹,
Heft 49, S. 770.)
Der angekündigte Quitzow-Roman startete früher als
geplant in Nummer 10 der ›Feierstunden‹ unter dem
Autorennamen ›Karl May‹. Er sprang für den schwerkranken
Friedrich Axmann ein, der dann am 20. November 1876 an
Lungentuberkulose in Blasewitz bei Dresden verstarb. Und
auch May ließ Quitzows Schicksal unvollendet:
»In dieser Zeit der Entwicklung [Februar 1876] war es, daß
Münchmeyer von auswärtigen Behörden wegen der Verbreitung
des ›Venustempels‹ [Geschichte der Prostitution und ihre
Entstehung] angezeigt wurde. … Es wurde Münchmeyer von
irgendeiner Seite verraten, von welcher, das weiß ich nicht,
daß eine Haussuchung nach dem ›Venustempel‹ stattfinden
werde. ... Man schaffte eine Menge der gefährdeten Bücher in
die Privatwohnungen und verbarg sie sogar unter den Betten
der Kinder. Das ging so schnell und gelang so gut, daß die
Polizei, als sie sich einstellte, kaum eine ganz geringe
Nachlese fand, und noch lange hat man sich im
Münchmeyerschen Hause des Schnippchens gerühmt, welches
damals der sonst so findigen Dresdener Behörde geschlagen
worden sei. Ich erfuhr erst später, viel später hiervon und
zog meine Konsequenzen. Meines Bleibens war hier nicht. Ich
wollte aus dem Abgrund heraus, nicht aber wieder hinunter!«
Im Sommer 1876 stand Karl May unter Anklage wegen seiner
Mitarbeit am Buch der Liebe (Nachfolgewerk des
›Venustempels‹). Ferner angeklagt waren Münchmeyers Bruder
Friedrich als Herausgeber sowie Otto Freitag als Redakteur
des ›Venustempels‹. In dieser Situation drängte Pauline
Münchmeyer, die Frau des Verlegers, Karl May zur Ehe mit
ihrer Schwester Minna Ey. Damit war das Ende der
Redakteurzeit besiegelt:
»Ich sagte ›nein‹ und kündigte, denn nun verstand es sich
ganz von selbst, daß ich nicht bleiben konnte, zumal es um
diese Zeit war, daß ich über jenen Streich, den man der
Dresdener Polizei gespielt hatte, das Nähere erfuhr. … Als
das Vierteljahr vorüber war, zog ich von Münchmeyers fort,
doch nicht von Dresden.«
Noch während der vierteljährlichen Kündigungszeit wurde May
freigesprochen. Er hatte mit seinem Buch der Liebe
unsittliche Stellen abgemildert. Ende Oktober 1876 (spätere
Äußerungen des Dichters verweisen immer auf das Jahr 1876)
verließ May die Münchmeyer-Redaktion und zog in die
Pillnitzer Str. 72, wo er noch notwendige Manuskripte
schrieb – den Quitzow zunächst fortsetzte.
Beendet wurde Mays Quitzow schließlich von Dr.
Heinrich Goldmann, seinem Nachfolger in der
Münchmeyer-Redaktion, der noch vor Erscheinen der
Schlusslieferungen am 9. Mai 1877 plötzlich verstarb.
Stets am Sonnabend wurde die Zeitschrift ›Feierstunden am
häuslichen Heerde‹ vom Verlag H. G. Münchmeyer, Dresden,
ausgeliefert. Die Veröffentlichung des Quitzow-Romans
erfolgt auf unseren Internetseiten – ungekürzt – in der
damaligen Rechtschreibung der Erstausgabe.
|