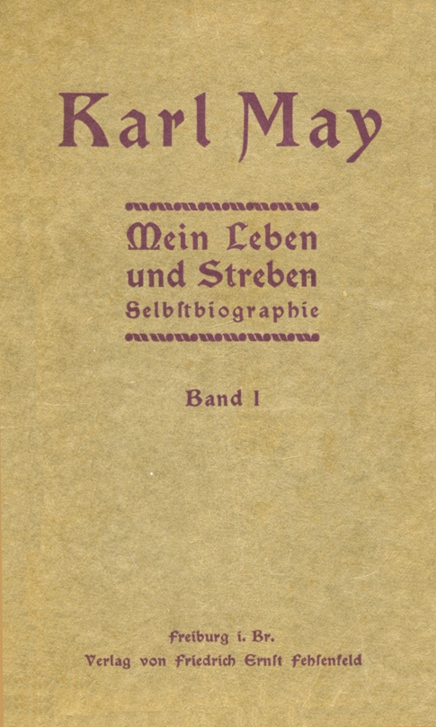
Karl May gilt als schillernde Persönlichkeit.
Und sein Werk gilt als exotische Spannungs- und Abenteuerliteratur,
verfasst von einem Autor, der selbst nie erlebt hat, was er mit
täuschender Geschicklichkeit beschrieb. Dirigierte nun – wie manche meinen
– das ›Fälschertalent‹ zeitlebens Mays Denken und Handeln, seinen gesamten
Daseinsentwurf und sein ganzes literarisches Schaffen – bis hin zur
Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹ (1910)?
1 Der Schriftsteller und sein Werk
Von seinen Prozessgegnern wurde Karl May schon zu Lebzeiten als frecher
»Münchhausen«, als »Betrüger« und »Allerweltsschwindler« (S. 302f.)[1]
gescholten. Solche Beschimpfungen – die den Zweck hatten, Mays
Glaubwürdigkeit vor Gericht zu erschüttern – hat der Schriftsteller stets
zurückgewiesen. Die Anwürfe empfand er als Stigmatisierung, als schwere
Beleidigung, als gröbstes Unrecht, unter dem er, in den letzten
Lebensjahren, über alle Maßen zu leiden hatte – freilich nicht ganz ohne
eigene Schuld.
Einem gängigen, bis heute nicht überwundenen
Vorurteil zufolge war Karl May ein pathologischer Lügner, ein kurioser
Prahlhans, ein unbedeutender Angeber oder ein gerissener Schwindler. Dem
verbreiteten Klischee nach ist alles, was er geschrieben hat, zum einen
Teil nur Plagiat (abgekupfert aus Lexikonartikeln und allen möglichen
Büchern) und zum anderen Teil nur reine Erfindung, ohne besonderen Sinn
und ohne tiefere Wahrheit. Wer sich von derartigen Vorurteilen
bestimmen lässt, wird auch die autobiographischen Schriften Karl Mays für
pure Fiktion oder, bei milderem Urteil, für Phantasieprodukte mit
eingestreuten Wahrheitselementen betrachten. Gegen solche Tendenzen sehe
ich das Gesamtphänomen Karl May – und speziell die Selbstbiographie ›Mein
Leben und Streben‹ – grundsätzlich anders und, wie ich meine,
differenzierter.
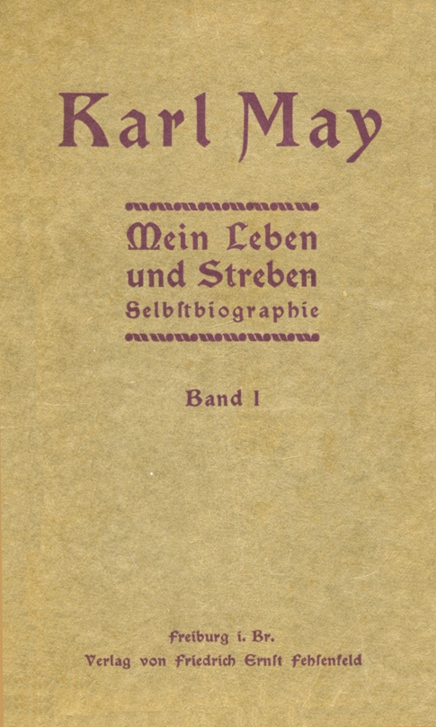
Karl May war ein komplizierter, ein vielschichtiger und (in mancher
Hinsicht) schwieriger Mensch, der keineswegs nur Unterhaltungsfutter für
unreife Buben geliefert hat. Dem Inhalt und der Form nach hat er, in knapp
vierzig Schriftstellerjahren, sehr Unterschiedliches produziert, darunter
(streckenweise) Triviales und Kitschiges – bisweilen auch
Kompilatorisches, d. h. partiell von anderen Autoren Übernommenes. Aber er
hat – in allen Schaffensperioden – auch sehr Anspruchsvolles,
unverwechselbar Originales und literarisch höchst Wertvolles geschrieben.
Ich persönlich bevorzuge das Spätwerk, beginnend mit dem – eher
mystisch-theologischen – Roman ›Am Jenseits‹ (1899). In diesen späteren
Schriften findet May immer mehr zu sich selbst, zur inneren Wahrheit
seines ›Lebens und Strebens‹. Auch seine indirekte Selbstkritik, sein
feiner werdendes Gespür für die eigenen Schwächen und die eigenen
Abgründe, wird im Alterswerk transparent. Was freilich auch in den
Spätwerken dominiert, ist die Zuversicht, die brennende Sehnsucht, dass
das Schöne, Wahre und Gute sich durchsetzen werde – im Ganzen der Welt wie
im Einzelfall Karl May.
Von allen Büchern, die May uns geschenkt hat, gefällt
mir, neben dem Doppelroman ›Ardistan und Dschinnistan I/II‹ (1907/09), die
Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹ am besten. In beiden Werken, im
Roman wie in der Autobiographie, geht es um Menschheitsprobleme,
um Fragen von allgemeiner Bedeutung. Beide Texte sind über weite Strecken
herausragend schön im literarästhetischen Sinne. In beiden Büchern ist die
zentrale Botschaft die Hoffnung – die feste, im Glauben an Gott begründete
Hoffnung auf den endgültigen Sieg des Guten über die Mächte der
Finsternis. Und beide Erzählungen sind wahr – wenn auch in jeweils ganz
anderer, der unterschiedlichen literarischen Gattung entsprechender Weise.
Inwiefern nun ist ›Mein Leben und Streben‹ ein wichtiges Buch und eine, in
doppelter Hinsicht, wahre Geschichte? Dieser Fragenkomplex ist im
Folgenden zu erörtern.
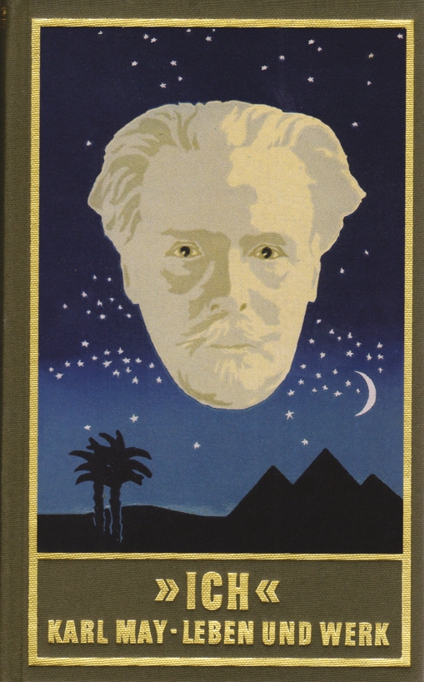
Das Standardwerk »ICH« aus dem Karl-May-Verlag
ist nach wie vor einer der wichtigsten und authentischsten
Biographiebände in der Sekundärliteratur.
2 Das Märchen von Sitara
Seiner Selbstbiographie hat Karl May ›Das Märchen von Sitara‹ mit den
allegorischen, dem genannten Spätwerksroman entnommenen Landschaften
Ardistan und Dschinnistan vorangestellt. Beide Länder gehören zu Sitara,
einem imaginären Planeten – einem surrealistischen Spiegelbild unserer
Erde mit ihrem Licht und ihrer Dunkelheit.
Diese Sitara-Präambel ist freilich, dem literarischen Genre nach, weniger
ein ›Märchen‹, sondern viel eher eine metaphorische Lehr-Erzählung: eine
Paränese, eine dringliche Einladung des Autors an seine Leser (und an sich
selbst), das eigene Leben neu zu bedenken und sich, u. U., neu zu
orientieren. Im Kern ist ›Das Märchen von Sitara‹ ein moralisches
Manifest, ein – in poetische Bilder gekleidetes – ethisch-religiöses
Bekenntnis des Verfassers. Und zugleich ist es ein Vorstellungsmodell für
transzendente, die Welt des Sichtbaren und Greifbaren übersteigende
Wirklichkeiten.
Als »Land der Gewalt- und Egoismusmenschen« (S. 2) ist Ardistan ein
einziges Jammertal, ein Bild des Elends und des Schreckens, ein Gleichnis
für das Böse und Üble in seinen vielen Gestalten. »Ard«, erklärt uns der
Dichter, »heißt Erde, Scholle, niedriger Stoff, und bildlich bedeutet es
das Wohlbehagen im geistlosen Schmutz und Staub, das rücksichtslose
Trachten nach der Materie, den grausamen Vernichtungskampf gegen Alles,
was nicht zum eigenen Selbst gehört oder nicht gewillt ist, ihm zu
dienen.« (S. 2)
Somit steht Ardistan für das ›Tiefland‹ der Erde, für die Niederungen des
Daseins, für primitive Genusssucht, für hässliche Triebe, für die
Missgunst und den Neid, für Gemeinheit und Raffgier, für stumpfe
Gleichgültigkeit, für Lüge und Betrug, für den Missbrauch der Macht, für
die Unterdrückung der Schwachen, für geistige (u. U. auch materielle)
Armut und für seelische Not. Alle diese Laster bzw. Nöte machen das Leben
in Ardistan – der ›dunklen‹ Teil-Wirklichkeit von Sitara – zum Albtraum
oder zur Hölle.
»Dschinni« indessen »heißt Genius, wohltätiger Geist,
segensreiches, unirdisches Wesen« (S. 2). Dschinnistan[2]
– die andere, lichtvolle, Seite von Sitara – ist »das Territorium der wie
die Berge aufwärtsstrebenden Humanität« (S. 2). In diesem Land wird jede/r
zum »Schutzengel« (S. 3) eines anderen Menschen. Somit steht Dschinnistan
für das ›Hochland‹ des Geistes und der Seele, für Wahrhaftigkeit und
Edelmut, für Barmherzigkeit und Versöhnung, für bedingungslose
Nächstenliebe, für inneren und äußeren Frieden, für Recht und
Gerechtigkeit, für die Einheit des Menschen mit Gott und der Schöpfung,
für das wiederhergestellte Paradies.
Die Abgründe, die giftigen Sümpfe, alle die Niedrigkeiten Ardistans zu
verlassen und, durch schwere Prüfungen hindurch, die Höhen Dschinnistans
zu erreichen, dies ist – im ›Märchen von Sitara‹ – der eigentliche
Entwicklungsweg, die vornehmliche Aufgabe des Menschengeschlechts und der
individuellen Existenz. In diesem ›Märchen von Sitara‹, in der Weltparabel
von ›Ardistan und Dschinnistan‹, sah der ältere – zunehmend an
christlich-humanen Werten orientierte – Karl May den Schlüssel zum
Verständnis des Universums und des eigenen ›Lebens und Strebens‹.
3 Strittige Fragen
Der eigentliche Text der Autobiographie ›Mein Leben und Streben‹ schließt
sich unmittelbar an ›Das Märchen von Sitara‹ an. Beide Texte, ›Das Märchen
von Sitara‹ und ›Mein Leben und Streben‹, sind ihrem Wesen nach
grundverschieden und bilden doch eine innere Einheit.
»Ich bin im niedrigsten, tiefsten Ardistan geboren, ein Lieblingskind der
Not, der Sorge, des Kummers.« (S. 8) Allein schon dieser erste Satz der
May’schen Selbstbiographie hat mich, als ich ihn im Alter von ca. 14
Jahren zum ersten Mal gelesen hatte, in ganz eigenartiger Weise berührt.
Seither gehört ›Mein Leben und Streben‹ zu den Büchern, die mich
persönlich faszinieren, die ich immer wieder in die Hand nehme und deren
Inhalt mich auch künftig sehr beschäftigen wird.
Im Unterschied zum Märchen von Sitara – dem rein poetischen,
symbolistischen, durch und durch gleichnishaften ›Prolog im Himmel‹ –
erhebt der biographische Text ›Mein Leben und Streben‹ den Anspruch, eine
reale Darstellung der Lebensgeschichte des Verfassers zu sein. Im Blick
auf aktuelle Diskussionen muss allerdings gefragt werden: Ist Mays
Selbstbiographie in den Hauptpunkten glaubwürdig? Ist sie, was
Sachverhalte und Daten im Leben des Autors betrifft, wesentlich
glaubwürdiger als die fiktionalen Ich-Inszenierungen in den
Abenteuerromanen Winnetou oder Old Surehand? Ist sie sehr viel ernster zu
nehmen als Mays – in den Renommierjahren entstandene – pseudobiographische
Selbstdarstellung ›Freuden und Leiden eines Vielgelesenen‹ (1896)?
Blieb May auch nach seinen Betrugsdelikten (die insgesamt einen Schaden
von ca. 1000 Mark verursachten, für die er aber insgesamt acht Jahre
hinter Mauern verbrachte) so etwas wie ein ›Trickbetrüger‹, nur eben mit
anderen, mit literarischen Mitteln? Und finden wir solche Tricksereien
auch noch – und vielleicht erst recht – im letzten Werk Karl Mays, in der
Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹?
So wäre zum Beispiel zu fragen: Ist May wirklich, wie er in der
Autobiographie behauptet, in seiner frühen Kindheit blind gewesen? War er
während seiner Straftäterzeit tatsächlich, wie er ja ebenfalls schreibt,
psychisch gestört und deshalb nur eingeschränkt schuldfähig? Oder hat er
sich in der letzten Lebensdekade, unter dem Druck der Pressekampagne gegen
sein Werk und seine Person, völlig neu ›erfunden‹? In einer grandiosen
Fiktion, wie sie dem »sächsischen Phantasten«,[3]
dem »genialen Spinner« und »herrlichen Lügenbold« (Hermann Kant)[4] wohl zuzutrauen wäre?
Wohlfeile, herablassende und eindimensionale Etikette
wie »Phantast« oder »Spinner« oder »Lügenbold« verfehlen zwar (auch wenn
sie wohlwollend gemeint sind und augenzwinkernd daherkommen) das
eigentliche Problem. Der Vielschichtigkeit des ›Phänomens Karl May‹ werden
sie überhaupt nicht gerecht. Sie verstärken nur die Klischees und die
Halbwahrheiten, die über May seit jeher verbreitet wurden. Gleichwohl kann
man kritische Fragen stellen:
Hat Karl May seine Jugenddelikte und seine Straftaten (in den 1860er
Jahren) in ›Mein Leben und Streben‹ nicht allzu sehr verharmlost und
beschönigt? Gibt es nicht, in mancherlei Hinsicht, viele Unstimmigkeiten
in dieser Selbstbiographie? Trifft es zum Beispiel zu, dass – wie May
beteuert – schon die ›Reiseerzählungen‹ der 1880/90er Jahre
metaphorisch-symbolisch gemeint waren? Und dass das erzählende »Ich« von
Anfang an als Allegorie für die »Menschheitsfrage« gedacht war und nicht
als real existierende, mit dem Autor Karl May identische Figur?
4 Das Reale und das Ideale
Bevor ich auf einzelne – strittige – Fragen zu Mays Vita eingehe, möchte
ich den Titel der Mayschen Autobiographie näher beleuchten. Wir müssen
diesen Titel – ›Mein Leben und Streben‹ – genau beachten. Der Titel
schließt ja die, meines Erachtens höchst wichtige, Aussage mit ein: Was
einen Menschen ausmacht, was zu seinem innersten Wesen gehört, ist nicht
nur sein tatsächliches Leben, sondern mindestens ebenso sehr sein Wollen,
sein Sehnen, sein Streben.
Anders gesagt: Bei der Beurteilung eines menschlichen Charakters zählt
nicht nur das, was momentan ist, sondern mehr noch das, was – nach der
Überzeugung dieses Menschen, dessen Vita ich betrachte – eigentlich sein
sollte, was von ihm erträumt, was von ihm zutiefst gewünscht und erstrebt
wird. Was einen Menschen kennzeichnet, was seine innere ›Wahrheit‹
definiert, ist nicht nur sein »Leben«, nicht nur die vorläufige
Wirklichkeit seines Existierens, sondern – ganz wesentlich – auch seine
Werteskala, die Summe seiner Ideale, seiner Lebensziele, also sein
»Streben«.
Aus diesem Grund ja hat May den Prolog ›Das Märchen von Sitara‹ der
eigentlichen Selbstbiographie vorangestellt. Mit diesem ›Märchen‹ wollte
er sagen: Sein Leben ist zwar weithin ein Kampf zwischen »Ardistan« und
»Dschinnistan«, d. h. zwischen den ›dunklen‹ Mächten in der eigenen Seele
und den ›hellen‹ Energien des göttlichen Lichtes im eigenen Innern; sein
Streben aber ist allein nur »Dschinnistan«, das Reich der Liebe und der
wahren Menschlichkeit. Diese – spirituelle – Intention des Dichters müssen
wir sehen und ernst nehmen. Andernfalls wäre uns der Zugang zu Mays
Selbstbiographie und ihrem Wahrheitsgehalt von vornherein verschlossen.
Auf das reale Leben kommt es an – aber nicht weniger auf das
idealistische Streben. Doch dieses Streben, »Dschinnistan«, hatte
bei May – als ›Himmelsgedanke‹, als Suche nach dem ›Reich Gottes‹ – eine
geistliche, eine religiöse Qualität. Diesen spirituellen Hintergrund in
Mays ›Leben und Streben‹ sollten wir, unabhängig vom eigenen Standpunkt,
respektieren.
May sehnte sich nach einer höheren, göttlichen Wahrheit, die sich in
irdischen Gegebenheiten nicht erschöpft. Diese Sehnsucht und dieses
besondere Wahrheitsverständnis brachte er in ›Mein Leben und Streben‹ in
enge Verbindung mit der religiösen Lebenseinstellung der
›Märchengroßmutter‹: Sie »war in der tiefsten Not geboren und im tiefsten
Leide aufgewachsen; darum sah sie Alles mit hoffenden, sich nach Erlösung
sehnenden Augen an. Und wer in der richtigen Weise zu hoffen und zu
glauben vermag, der hat den Erdenjammer hinter sich geschoben und vor sich
nur noch Sonnenschein und Gottesfrieden liegen.« (S. 20f.)
Mit diesen Sätzen hat Karl May, der »im niedrigsten, tiefsten Ardistan«
(S. 8) geborene Dichter, ganz gewiss auch sich selbst gemeint. Denn
zeitlebens blieb er ein hoffender, auf die Verheißungen Gottes
vertrauender Mensch. Der ehemalige Schullehrer und Katechet blieb auch als
Schriftsteller ein – geschickter und passionierter – »Ausleger der
Bibel«:[5] ein Interpret der Menschheitsträume,
der Prophetien, Visionen und Hoffnungen, wie sie in der Bibel (zum Teil
auch in den Weltreligionen, auch in den Märchen und Mythen) dokumentiert
sind. Der Autor von Indianer- und Beduinengeschichten blieb zugleich ein
›Prediger‹ und ›Katechet‹. Und bei aller Offenheit für andere Religionen
standen ihm der (übernatürliche) Realitätsbegriff und der
Wahrheitsanspruch des biblisch-christlichen Glaubens immer am nächsten.
Jedenfalls verstand sich May immer, zumindest dem Streben nach, als gläubiger Mensch:[6] »Die Ueberzeugung, daß es einen Gott gebe, der auch über mich wachen und mich nie verlassen werde, ist, sozusagen,[7] zu jeder Zeit eine feste, unveräußerliche Ingredienz meiner Persönlichkeit gewesen« (S. 95). Das ›Mystische‹, die religiöse Sehnsucht bei May sollten wir also nicht, wie manche Forscher es gerne tun, als Luftblase oder Nebensache verachten.
Nein, das christlich-idealistische Streben des
›Maysters‹ sollten wir als konstitutives, als grundlegendes Element seines
Seins verstehen – und nicht als Kosmetik, nicht als überflüssiges Beiwerk
(und schon gar nicht als Täuschungsmanöver, als listiges Falschspiel eines
Fabulierers und Verwandlungskünstlers).
5 Das Religiöse und das Wahre
Wenn es um den Wahrheitsgehalt in ›Mein Leben und Streben‹ geht, muss das
Credo, das religiöse Bekenntnis des Autors in die Überlegungen mit
einbezogen werden – und zwar an vorderster Stelle. Denn seinen Anspruch
auf Glaubwürdigkeit hat May selbst ja im religiösen Sprachspiel, ›im Namen
Gottes‹, bekräftigt und gleichsam beeidigt.
Er habe als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener auf Gottes Nähe und
Führung vertraut; er habe »stets und bei jeder Veranlassung gebetet«; ja
er »tue das auch noch heut«, ohne sich »zu genieren«. So lesen wir in Mays
Selbstbiographie (S. 95f.). Von Gott, vom Glauben an Gott, vom Vertrauen
auf Gottes Walten, von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist dort – wie
überhaupt in den Spätwerken Karl Mays – durchgängig die Rede.
Eine feste Überzeugung, ein echtes Glaubensbekenntnis des Autors? Oder
vielleicht nur ein Selbstbetrug? Oder gar eine Irreführung der Leser, ein
Lippenbekenntnis, ein Haschen nach Mitgefühl und Bewunderung?
Natürlich sind Mays Aussagen über den eigenen Gottes- bzw. Christusglauben
nicht überprüfbar im Sinne wissenschaftlicher, empirisch-experimenteller,
Reproduzierbarkeit. Diese Feststellung gilt jedoch für die Gottesrede und
das religiöse Sprachspiel überhaupt.
Vergleichbar mit existenziellen Grunderfahrungen (mit Erfahrungen wie
Freundschaft und Liebe, Glück und Erfüllung, Trauer und Schmerz, Hoffnung
und Sehnsucht) ist auch die religiöse Erfahrung nicht verifizierbar im
wissenschaftlichen Experiment. Aber auch die Religion bzw. die religiöse
Sprache kann wahr sein – so echt und so wahr, wie die ›Tiefe‹ bzw. das
Unergründliche, Geheimnisvolle, ›Jenseitige‹ unseres Daseins – in der
subjektiven Transzendenz-Erfahrung – wahr und real ist.[8]
In der Sicht Karl Mays jedenfalls (und in der Sicht vieler
Ähnlichgesinnter in allen Kulturkreisen und in allen Epochen der
Menschheitsgeschichte) ist der Glaube an Gott – d. h. an eine
unendliche, bedingungslose Liebe – absolut wahr.
Der Journalist, Theaterkritiker und May-Biograph Rüdiger Schaper freilich quittiert die religiöse, bzw. philosophisch-theologische, Dimension in ›Mein Leben und Streben‹ (und auch sonst in Mays Leben und Werk) eher mit Skepsis und Ironie.[9] Ich kann das, bis zu einem gewissen Grade, verstehen. Allerdings finde ich Schapers Darstellungsweise, auch wenn sie brillant und ausnehmend flott wirkt (und viele geistvolle Thesen, oftmals auch kenntnisreiche Passagen und erstaunliche Querverweise enthält), nicht immer treffend und nicht immer korrekt – vor allem was die religiösen Perspektiven in ›Mays Leben und Streben‹ betrifft.
Rüdiger Schaper durchschaut interessante Teil-Aspekte
des ›Phänomens Karl May‹. Auf seine, eher feuilletonistische, Art ist er
ein wortstarker May-Sympathisant, der ›unserem Autor‹ einen ehrenvollen
Platz in der Weltliteratur, mit besten Gründen, zuerkennt. Freilich hat
Schapers Darstellung auch ihre Schlagseiten. Eine May-Biographie muss zwar
natürlich nicht ›fromm‹ sein. Aber Mays biblisch geprägte Glaubenswelt
sollte der Interpret, meiner Meinung nach, in angemessener Weise beachten
und nicht – teilweise – als einfältige Schwärmerei und – zum anderen Teil
– als Geniestreich, als eine Art Taschenspielertrick, in Misskredit
bringen. Jedenfalls würde ich nicht sagen, dass »das Schwindeln« bei May
einen »immer stärker« werdenden »religiösen Charakter« bekomme.[10]
6 Ein pseudoreligiöser Schwindler?
Wir müssen deutlich unterscheiden: Die Frage nach der Wahrheit des
Gottesgedankens als solchem ist etwas anderes als die Frage nach der
Echtheit – oder Verlogenheit – der religiösen Sprache bei einer konkreten
Person, zum Beispiel bei Karl May. Diesen Unterschied hat May selbst sehr
genau gekannt und in seinen Büchern – auch in ›Mein Leben und Streben‹ (z.
B. S. 102) – besonders intensiv und auffällig oft beschrieben. War May
also ein religiöser Bekenner, ein aufrechter, glaubwürdiger Christ? Oder
war er (wie schon, nach 1900, seine kirchlichen Gegner meinten) ein
Heuchler, ein scheinheiliger Schwindler? Oder war er beides zugleich, mal
eher ein Christ, mal eher ein Scheinchrist?
Aufgrund des Gesamttenors in Karl Mays Schriften und aufgrund des
Zeugnisses vieler Zeitgenossen, die ihn persönlich gekannt haben, bin ich
mir sicher: Mays Glaube, sein Christsein war echt. Gleichzeitig war er –
wie seine umfangreiche Korrespondenz und auch seine Selbstbiographie
belegen – ein kluger Kopf, ein kritischer Geist, ein aufgeklärter und
aufklärender Denker und alles andere als ein unbedarfter oder bigottischer
Mensch. Dennoch kann die religiöse Selbstdarstellung Karl Mays hinterfragt
und kritisiert werden. Insbesondere die Art, wie May – nach 1900 – das
eigene Leiden mit dem Leiden Christi verglich (z. B. S. 169), grenzt
manchmal ans Bedenkliche und schon fast ans Blasphemische. May war sehr
eitel und neigte, wie seine Romanfigur Hadschi Halef, zur
Selbstgefälligkeit, ja, in schwachen Stunden, zur Selbstbeweihräucherung.
Zudem hatte er – jenseits des Religiösen – einen, mitunter skurrilen, Hang
zum Übertreiben und Schwadronieren (exzessiv in den 1890er Jahren). Mit
dieser Renommiersucht, die bisweilen auch religiöse Züge annehmen konnte,
stand Karl May sich selber im Weg. Das alles ist richtig, dies muss so
gesagt werden.
Doch derartige Kritik, so nötig sie ist, trifft den Kern der Wahrheit
nicht ganz, vielleicht noch nicht einmal halb. Denn Mays religiöse
Lebenseinstellung scheint mir, wie gesagt, überwiegend fundiert und
gediegen. Und vor allem sind die, gelegentlichen, pseudoreligiösen
Auswüchse kein Argument gegen die grundsätzliche Redlichkeit der Aussagen
Mays in ›Mein Leben und Streben‹.
»Karl May schwindelt«, so Rüdiger Schaper, »dass sich die Balken seiner
Luftschlösser biegen.«[11] So forsch, so
pauschal, so definitiv kann man das nun wirklich nicht behaupten. Wie
Schaper selbst ja wohl einräumen würde, dürfen bestimmte Episoden in Mays
Vita, auch wenn es Rückfälle gab, nicht überinterpretiert und nicht
hochgespielt werden: zum Auslegungsprinzip für Mays Biographie überhaupt.
Was May, wie immer man ansonsten zu ihm stehen mag,
in jedem Fall zu glauben ist: Er strebte nach den Höhen von
»Dschinnistan«, er wollte sich der Wahrheit stellen, er suchte das
Wahre und Gute, er sehnte sich nach einer Liebe, die alles
durchdringt und die niemals vergeht. Zumindest insofern – und
allein schon diesen Aspekt finde ich höchst bedeutsam – ist ›Mein Leben
und Streben‹ eine Selbstbiographie, die, jenseits von poetischen
Ausschmückungen, eine tiefe religiöse Wahrheit enthält.
7 Mays Autobiographie als poetisches Werk
Mays Autobiographie wurde schon mit Goethes Selbstbiographie Aus meinem
Leben. Dichtung und Wahrheit verglichen. Im Anschluss an den
Literaturwissenschaftler Helmut Schmiedt sah der May-Biograph Hans
Wollschläger in ›Mein Leben und Streben‹ ein »streckenweise parallel
angelegtes Gegenbild« zu Dichtung und Wahrheit.[12] Die Frage ist nun: Wie verhalten
sich Dichtung und Wahrheit in Mays Selbstbiographie? (Wobei, um dies
gleich vorwegzunehmen, ›Dichtung‹ und ›Wahrheit‹, kunstvolle Ausdrucksform
und Übereinstimmung mit der tieferen Wirklichkeit, keine Gegensätze sein
müssen!)
Mays Autobiographie ist zweifellos ›Dichtung‹. In einem frühen Artikel (1985) betonte Helmut Schmiedt: »Beides gilt: May schrieb einen um die Darlegung empirischer Tatsachen bemühten Bericht und ein poetisches Werk, das sich gattungsspezifischer Topoi, singulärer Muster und literarischer Verklausulierungen bedient.«[13] Mit anderen Worten: ›Mein Leben und Streben‹ orientiert sich, partiell, an Vorlagen aus der Feder anderer Dichter (z. B. Hebels[14] und Goethes) und beansprucht zugleich den Charakter einer realen Lebensbeschreibung. Ich stimme Schmiedt hier grundsätzlich zu. Wie aber steht es dann um den Wahrheitsgehalt, um die »Präzision und Korrektheit der von May notierten Fakten«?[15]
Unstrittig ist: Wenn wir – zum Beispiel – bei Goethe wie auch bei May die Aussage finden, das Puppentheater habe ihre Kindheit und ihre spätere Dichtung aufs stärkste beeinflusst, so heißt das natürlich nicht, dass Mays Schilderung (S. 55ff.) eine nachahmende Erfindung sei. Vielmehr steht fest: Im »Webermeisterhause« (S. 55) in Mays Heimatort Ernstthal hat es in den 1850er Jahren tatsächlich solche Puppenspiele gegeben.[16] Dass der halbwüchsige Karl die eine oder andere Aufführung persönlich erlebt hat und von hochdramatischen Szenen (z. B. im Volksstück Doktor Faust) zuinnerst berührt wurde, ist unbedingt anzunehmen.
Oder ein anderes Beispiel: Wenn es in den
Selbstbiographien Goethes und Mays bestimmte Parallelen hinsichtlich der
Grundkonstellationen in den Herkunftsfamilien gibt,[17]
so heißt das gewiss nicht, dass May (um den Dichterfürsten Goethe oder den
Erzähler J. P. Hebel zu imitieren) die Charaktere, bzw. die
Verhaltensweisen, seiner Eltern oder seiner ›Märchengroßmutter‹
verzeichnet hätte. Denn dafür gibt es ansonsten ja keinerlei
Anhaltspunkte. Vielmehr wird sich Karl May – falls von einer bewussten
Adaption überhaupt die Rede sein kann – bei der Lektüre Goethes bzw.
Hebels gedacht haben: So ähnlich war es, mutatis mutandis, bei meinen
Eltern bzw. bei meiner Großmutter doch auch!
8 Zum Wesen jeder Selbstbiographie
Wie aber ist es im Übrigen mit dem Wahrheitsgehalt in ›Mein Leben und
Streben‹ bestellt? Im Rahmen der vorliegenden Abhandlung kann ich nicht
auf jeden einzelnen, für Mays Vita relevanten und in der heutigen
May-Forschung umstrittenen Punkt eingehen. Ich greife nur wenige, mir
besonders wichtig erscheinende Streitpunkte auf.
Zunächst aber sei grundsätzlich gefragt: Bis zu welchem Grad überhaupt kann eine Selbstbiographie objektiv ›wahr‹ sein? Was eigentlich heißt, im Blick auf eine Lebensbeschreibung, ›wahr‹? Ist eine Autobiographie wahr, wenn alle Details, von denen berichtet wird, nachweislich stimmen? Müssen alle Ereignisse, von denen erzählt wird, einer genauen Überprüfung standhalten? Und muss alles zur Sprache kommen? Darf in der Offenlegung von Sachverhalten nichts Nennenswertes fehlen?
Nein – in diesem Sinne vollständig ›wahr‹ kann eine Selbstbiographie ihrem Wesen nach gar nicht sein. Kein Mensch kann sich nach Jahren und Jahrzehnten noch exakt erinnern, was im Einzelnen alles geschehen ist. Gedächtnislücken, Erinnerungssperren, chronologische Fehler, Unstimmigkeiten in vielen Details sind in Autobiographien eine unvermeidliche Selbstverständlichkeit.[18] Und nicht nur das! Mit größeren Verzerrungen, mit Verwechslungen, mit Blickverengungen, mit unbewussten Kontrollmechanismen, mit Wahrnehmungsverschiebungen ist immer zu rechnen. Naturgemäß sind Selbstbiographien subjektiv, ja tendenziös.
Menschliches Gedächtnis ist immer selektiv. In der Retrospektive wählt die Erinnerung aus, was ihr wichtig erscheint. Vieles wird schlichtweg vergessen, manches wird, aus welchen Gründen auch immer, ›verdrängt‹. Das gilt, wie gesagt, für jede Rückschau und für jede Selbstbiographie und folglich auch für Mays ›Mein Leben und Streben‹.
Schließlich muss bei der Bewertung des Wahrheitsgehalts von (poetischen oder nicht-poetischen) Selbstbiographien in jedem Falle berücksichtigt werden: Alles, was der Autobiograph schreibt, sollte nach Möglichkeit stimmen. Aber nicht alles, was stimmt, muss er schreiben. Denn es gibt einen berechtigten Selbstschutz, und es gibt einen notwendigen Schutz auch anderer Personen, die mit der eigenen Vita eng verbunden sind oder waren.
Etwas anderes freilich wäre es, wenn ein Autobiograph
signifikante Daten seiner Lebensgeschichte frei erfinden oder solche Daten
ohne Not (d. h. ohne die besagten Schutzgründe) verschweigen oder mit
Absicht entstellen würde. Von einer derartigen Fälschung, von einer
derartigen Täuschung der Lesergemeinde durch den Autor ist im Falle der
Mayschen Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹ freilich nicht
auszugehen.
9 Speziell zu ›Mein Leben und Streben‹
In seiner neuen Karl-May-Biographie (2011) allerdings setzt der, ansonsten
hervorragende, May-Kenner Helmut Schmiedt als Prämisse voraus, dass ›Mein
Leben und Streben‹ – ähnlich wie ›Meine Beichte‹ (1908) und die anderen
autobiographischen Schriften Karl Mays – »in besonders zugespitzter Form«
ein poetischer Text sei, der »mit dem Ziel der Selbstrechtfertigung«
verfasst wurde.[19]
Aus dieser Grundannahme zieht Schmiedt jetzt den Schluss: Den
Wahrheitsgehalt aller autobiographischen Schriften Mays müssten wir
generell sehr skeptisch bewerten (sofern sie nicht, punktuell, durch
sonstige Dokumente eindeutig bestätigt würden).
Helmut Schmiedt meint, wenn ich ihn recht verstehe, nicht nur die ›normalen‹ Gedächtnislücken, nicht nur die subjektiven Akzente, nicht nur die auch sonst in Autobiographien üblichen Blickverengungen usw. (s. oben). Vielmehr äußert Schmiedt – wie auch andere Autoren in der heutigen ›May-Szene‹ – sehr weitgehende Vorbehalte gegen die Glaubwürdigkeit von Mays Selbstbiographie insgesamt – weil sie im wesentlichen nur die Selbstrechtfertigung des Verfassers sei!
Ich bin da anderer Meinung. Allein nur als Selbstverteidigung ist ›Mein Leben und Streben‹ nicht hinreichend zu erklären. Für eine solche – einseitige und vereinfachende – Reduktion ist das Buch viel zu facettenreich, im Inhalt viel zu gewichtig und in der Tendenz ja durchaus ambivalent: Selbstverständlich will der Autor – wer wollte ihm das verübeln – sich selbst vor der Öffentlichkeit entlasten; aber er zeigt sich, in wichtigen Partien des Buches, zugleich auch selbst-kritisch und schuldbewusst. Was also den Wahrheitsgehalt speziell von ›Mein Leben und Streben‹ betrifft, halte ich einen Generalverdacht für unbegründet. (Ganz abgesehen davon, dass ein solcher, in der Sache fragwürdiger, Generalverdacht dem Andenken Karl Mays – aus meiner Sicht – alles andere als dienlich wäre.)
Das soll nun wirklich nicht heißen, dass Mays Vita
glorifiziert und Mays Persönlichkeit verherrlicht werden sollte. Ein
derartiges Unterfangen wäre töricht und würde Karl May im Grunde nur
schaden. Unser ›Mayster‹ war ja kein Heiliger, er war ein Mensch mit
seinem Widerspruch. Hierin stimme ich mit Schmiedt und anderen Interpreten
voll überein: May war ein hoch komplizierter Charakter, ein Wanderer
zwischen den Abgründen ›Ardistans‹ und den Höhen von ›Dschinnistan‹. Umso
mehr ist es mein Anliegen, Karl May und seiner Selbstbiographie – so gut
wie möglich – gerecht zu werden.
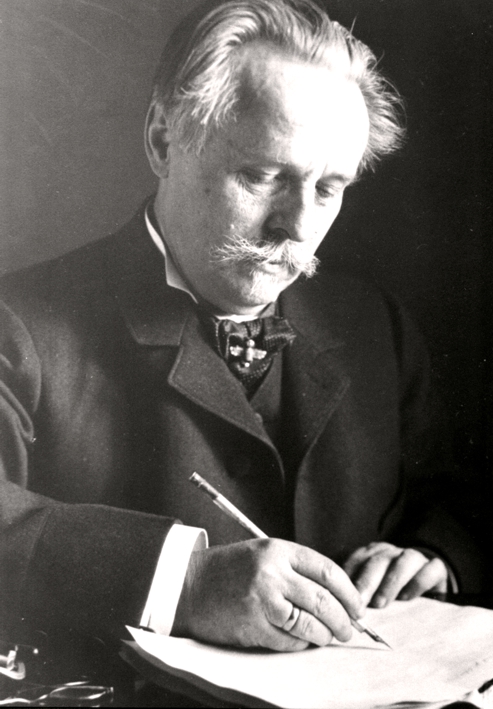
Karl May im Jahr 1906.
10 Existenzielle Lebensbetrachtung und
biographisches Quellenwerk
Es ist nicht zu bestreiten: Mays Selbstbiographie ist, der literarischen
Gattung entsprechend, sehr lückenhaft und in etlichen Punkten
unzutreffend. Keineswegs aber kann man sagen, dass ›Mein Leben und
Streben‹ in der Summe nicht glaubwürdig sei – weil es dem Autor allein um
sich selbst, um seine eigene Rehabilitierung gehe. O nein! Es geht in
›Mein Leben und Streben‹, zum nicht geringen Teil, um ganz andere Dinge
als um das Selbstporträt eines umstrittenen, von Freunden ermutigten und
von Gegnern gehassten Schriftstellers.
Nicht nur im Märchen von Sitara, sondern genauso in der eigentlichen Selbstbiographie ging es Karl May (ich werde darauf zurückkommen) auch und ganz wesentlich um Themen wie Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe, um Themen wie Schuld und Vergebung, innere Gefangenschaft und innere Befreiung. Es ging May, nicht zuletzt, um Themen wie Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit – um die großen Menschheitsthemen, die sein eigenes Ich sehr weit übersteigen.
Bei all diesen – existenziellen und spirituellen – Themen ging es dem Autobiographen, selbstredend, zugleich um die eigene Person. Es gibt jedoch keinen triftigen Grund für die Annahme, Karl May hätte in ›Mein Leben und Streben‹ in irgendwelchen Punkten bewusst die Unwahrheit gesagt und somit ›gelogen‹. Zwar hat May in seinen selbstbiographischen Äußerungen – da stimme ich Ekkehard Bartsch zu – »manches verschleiert, hat sich zum Beispiel nur mühsam und in einem quälenden Prozess dazu durchringen können, die Vorstrafen zuzugeben«.[20] Zweifellos werden wir vieles in Mays Selbstdarstellung korrigieren und präzisieren müssen. Aber ›Mein Leben und Streben‹ grundsätzlich und durchgängig »als Quellenwerk von nur zweifelhaftem Wert abzutun«, das wäre, so Ekkehard Bartsch, »der falsche Weg zur Wahrheitsfindung«.[21]
Mays Selbstbiographie gar als reine Fiktion,
gleichsam als romanhaftes Werk zu verstehen, wäre erst recht verfehlt.
Nein, was die Schilderung von wesentlichen Fakten betrifft, ist ›Mein
Leben und Streben‹ ein biographisch bedeutsamer und – aufs Ganze gesehen –
durchaus glaubwürdiger Text.
11 Eine »Prozess-Schrift«?
Gewiss ist Mays Selbstbiographie im Zusammenhang mit gerichtlichen
Auseinandersetzungen vor allem der Jahre 1904 bis 1910 zu sehen. Natürlich
wollte May seine Leser für die Wahrheit, wie er sie sah, einnehmen. Und
natürlich wollte er seine Gerichtsprozesse gewinnen. Einige Teile
der Autobiographie dienten – wie May selbst, in einem Brief vom 14.
November 1910 an den Freiburger Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld,
betonte[22] – speziell diesem Zweck.
Daraus folgt aber nicht, dass ›Mein Leben und Streben‹ – wie in der Sekundärliteratur bisweilen suggeriert wird – im Ganzen eine »Prozess-Schrift« wäre: ähnlich wie ›Ein Schundverlag‹ (1905), ›Ein Schundverlag und seine Helfershelfer‹ (1909) oder ›An die 4. Strafkammer des Königl. Landgerichtes III in Berlin‹ (1911). Dass May in ›Mein Leben und Streben‹ um ein neutrales und ausgewogenes Werk bemüht war, zeigt schon die Tatsache, dass er Beschreibungen aus der ›Pollmer-Studie‹ (1907) oder dem ›Schundverlag‹ (1905/09) – also den eigentlichen »Prozess-Schriften« – für die Öffentlichkeit deutlich entschärft hat.
In ›Mein Leben und Streben‹ allen Ernstes eine »Prozess-Schrift« sehen zu wollen, eine Schrift also, die vorwiegend um Rechtsstreitigkeiten rotiert, wäre absurd. Vielmehr ist diese Selbstbiographie ein mehrdimensionales Werk: ein Buch von hohem biographischen, literarischen und sozialethischen Wert, ein – ins Philosophische und Religiöse gehendes – Kunstwerk, dessen Zweck sich mitnichten im Gewinnen von juristischen Streitereien erschöpft.[23]
Der Autor erklärte seiner Lesergemeinde: »Ich schreibe dieses Buch nicht etwa um meiner Gegner willen, etwa um ihnen zu antworten oder mich gegen sie zu verteidigen […]. Ich schreibe dieses Buch auch nicht für meine Freunde, denn die kennen, verstehen und begreifen mich, so daß ich nicht erst nötig habe, ihnen Aufklärung über mich zu geben. Ich schreibe es vielmehr nur um meiner selbst willen, um über mich klar zu werden und mir über das, was ich bisher tat und ferner noch zu tun gedenke, Rechenschaft abzulegen.« (S. 11)
Diese Erklärung stimmt zwar nicht ganz. Karl May
hatte schon auch seine Gegner und seinen Selbstschutz im Blick.
Darüber hinaus aber dienen seine Darstellungen tatsächlich – weithin – der
Selbstreflexion. Sie sind nicht einfach abzutun als bloße
Schutzbehauptungen zum Zwecke der Rechtfertigung und der
Selbstglorifizierung des Autors. Trotz vieler Einseitigkeiten und trotz
ihres Fragmentcharakters enthalten Mays Ausführungen sehr viel Wahres, der
Selbsterkenntnis des Verfassers sehr Förderliches. Vor allem subjektiv
sind sie glaubwürdig: als, wie Hainer Plaul hervorhob, »vom festen Willen
zur Wahrhaftigkeit durchdrungene Bekenntnisse«.[24]
12 Erstaunliche Gedächtnisleistung
Aber auch objektiv liefert Mays Selbstbiographie sehr
brauchbares, von der Forschung in wichtigen Punkten bestätigtes, zum
Verständnis des ›Phänomens Karl May‹ unverzichtbares Material. Über die
von Hainer Plaul[25]
und anderen Forschern ermittelten biographischen Daten hinaus konnten auch
in jüngster Zeit wichtige Fakten geklärt werden, die den hohen
Wahrheitsgehalt von ›Mein Leben und Streben‹ noch zusätzlich erhärten.
Mittlerweile steht zum Beispiel fest, dass Mays autobiographische
Schilderung des ›Uhrendelikts‹ zu Weihnachten 1861 und der Verhaftung des
Junglehrers am Heiligen Abend (S. 103–107) in sehr vielen, ja vermutlich allen
Details dem objektiven Sachverhalt entspricht.[26]
Auch Mays Darstellung der Gefangenschaft im Arbeitshaus ›Schloss
Osterstein‹ (1865–1868) gewinnt, aufgrund neuer Erkenntnisse,[27] an Glaubwürdigkeit in den Details.
Es wird zwar nicht alles in allen Einzelheiten genau so gewesen sein, wie Karl May es beschreibt. Von für Selbstbiographien typischen Fehlern war ja schon ausführlich die Rede. Dennoch – so manche Ereignisse, die viele Jahrzehnte zurücklagen, hat May in ›Mein Leben und Streben‹ sehr präzise geschildert. Das wirkt umso erstaunlicher, wenn man berücksichtigt, dass ihm keine Erinnerungsfotos zur Verfügung standen und es keine älteren Geschwister oder sonstige Familienangehörige gab, die er hätte befragen können.
Gleichwohl halte ich fest: Die eigentliche
Wahrheit in ›Mein Leben und Streben‹ liegt noch wesentlich tiefer als in
der, ungewöhnlich guten, Erinnerung an äußere Lebensdaten. Die Bewertung
durch Hans Wollschläger gilt nach wie vor: ›Mein Leben und Streben‹ ist
»zu Recht in die literarische Dauer eingegangen […]; die ›Wahrheit‹ des
Werks liegt gänzlich außerhalb der Dokumente. […] Dabei erreicht auch die
faktische Wahrheit ein bei Selbstbiographien durchaus ungewöhnlich hohes
Maß, und die subjektiven Verschiebungen erweisen sich als nur zusätzlich
sprechend und aufschlussreich […], und eine bewusste Entstellung oder
Retusche ad hoc ist nirgends nachweisbar.«[28]
13 Zum Suizid des Großvaters
Erwiesenermaßen fehlerhaft sind Mays Ausführungen zu den Biographien der
Großeltern.[29] Doch solche Unstimmigkeiten
in einer Reihe von Einzelheiten sind leicht zu erklären (als
Erinnerungsfehler Karl Mays oder als Fehlinformationen von Seiten der
Eltern) und gewiss nicht als ›lügnerisch‹ zu bewerten.
Zweifellos unzutreffend – aber wohl kaum mit Absicht falsch wiedergegeben – ist beispielsweise Mays Angabe (S. 8) vom häuslichen Unfalltod des Großvaters mütterlicherseits. Nach dem Begräbnisbuch der Kirchengemeinde St. Christophori in Hohenstein hat sich Mays Großvater, der Weber Christian Friedrich Weise (1788–1832), im Keller des Nachbarn erhängt. »Ursache der Selbstentleibung: Trunkenheit und Verzweiflung«.[30]
Warum hat May die Sache beschönigt und aus dem Suizid einen Unfall gemacht? Wollte er, aus Gründen der Pietät, das Andenken des Großvaters schützen? Oder ging es ihm ums eigene Renommee? Wollte er vor der Lesergemeinde nicht als Enkel eines Versagers, eines Trinkers und Selbstmörders dastehen?
Viel wahrscheinlicher ist eine andere Erklärung: Karl May, der den Großvater ja gar nicht gekannt hatte und erst zehn Jahre nach dessen Tod geboren wurde, hat, wie ich vermute, vom Suizid des Großvaters Weise überhaupt nichts gewusst. Er hat in ›Mein Leben und Streben‹ – bona fide – berichtet, was ihm die Eltern (und vielleicht auch die ›Märchengroßmutter‹, Frau Johanne Christiane Vogel verw. May) erzählt hatten.
Wir dürfen nicht übersehen: Zu Mays Zeiten – und auch noch lange danach – galt der ›Selbstmord‹, der ›Freitod‹, als Schande und im christlichen Milieu sogar als schwere Sünde. Der ›Selbstmörder‹ – laut Aktennotiz auch der Großvater Mays – wurde in ungeweihter Erde verscharrt[31] und musste, nach allgemeiner Ansicht, mit der ewigen Hölle als jenseitiger Bestrafung rechnen. Heute freilich gehen die meisten Psychiater und Psychotherapeuten davon aus, dass der Suizid nur in den seltensten Fällen eine freiwillige Tat ist. Ich teile diese Auffassung. Meines Erachtens ist die Freiheit des Suizidanten in der Regel, aufgrund von psychotischen Zwängen oder aufgrund von katastrophalen äußeren Umständen, so gut wie ausgeschaltet.
Auch in den christlichen Konfessionen hat sich ein
entsprechender Bewusstseinswandel vollzogen. Der Suizid wird als
bedauerliche Fehlhandlung angesehen, aber kaum mehr als Sünde vor Gott.
Doch, wie gesagt, im Umfeld Karl Mays galt eine völlig andere Sichtweise.
Deshalb nehme ich an, dass Mays Familie dem kleinen Karl – und auch später
dem Erwachsenen – nicht die volle Wahrheit über den Tod des Großvaters
Weise übermittelt hat.

Auf dem ursprünglichen Hohensteiner Friedhof an der Dresdner Straße,
heute Parkanlage und Spielplatz, wurde Mays Großvater Christian
Friedrich Weise 1832 »an einem abgesonderten Ort des Gottesackers«
begraben.
14 Zur ›Spanien‹-Episode
Mays Version vom Tod des Großvaters ist jedenfalls
unstimmig, da sie ja aktenkundig widerlegt ist. Damit stellt sich für
mich, im Blick auf den Wahrheitsgehalt von ›Mein Leben und Streben‹, die
Methodenfrage: Nach welchen Kriterien sind Mays Aussagen bezüglich ihrer
faktischen Richtigkeit zu beurteilen? In welchen Fällen empfiehlt es sich,
Mays Angaben zu bezweifeln bzw. als unrichtig anzusehen? Hilfreich ist ein
Vergleich innerhalb des May’schen Oeuvres: Die pseudobiographischen
›Freuden und Leiden eines Vielgelesenen‹ (1896) erwecken von vornherein
den Eindruck einer Posse, einer launig-maßlosen Übertreibung in allem, was
beschrieben wird. Folglich sind die Freuden und Leiden, was Tatsachen
betrifft, mit dem nötigen Misstrauen zu lesen.
Die vierzehn Jahre später in einer ganz anderen Gemütsverfassung und unter
ganz anderen Lebensumständen entstandene Selbstbiographie ›Mein Leben und
Streben‹ indessen wirkt insgesamt (abgesehen von den grundsätzlichen, in
Abschnitt 8 benannten Einschränkungen) sehr glaubwürdig. Im Großen und
Ganzen scheint sie mir verlässlich. Deshalb bin ich sehr geneigt, auch
einzelne Passagen in ›Mein Leben und Streben‹ nur dann für fiktional zu
halten, wenn sie durch nachgewiesene Fakten falsifiziert werden können
oder wenn sie in sich selbst allzu unwahrscheinlich wirken oder wenn
plausible Verschleierungsmotive des Autors deutlich erkennbar sind.
Aber eine Schilderung Karl Mays allein schon deshalb in Frage zu stellen,
weil sie durch Dokumente nicht eindeutig bestätigt werden kann, halte ich,
wie gesagt, für unangebracht. Der Literaturwissenschaftler Andreas Graf
zum Beispiel hat Mays Darstellung vom – nach einem Tag schon beendeten –
Fluchtversuch des halbwüchsigen Karl nach Spanien (S. 79 u. 92f.)
angezweifelt: nur weil es in anderen, ebenfalls poetischen,
Autobiographien ähnliche Geschichten gibt und weil für die Ausreißer-Story
des Dichters, außer dessen Selbstzeugnis, »keinerlei Belege vorliegen«.[32] Dem setze
ich entgegen: Für Szenen dieser Art kann es naturgemäß keine
Belegdokumente geben! Aber sind sie deshalb schon unglaubwürdig? Nein, ich
sehe nicht den geringsten Grund, an Mays Darstellung zu zweifeln.
Ganz im Gegenteil: Die – natürlich gescheiterte – ›Flucht‹ des pubertären Karl nach ›Spanien‹, dem Land seiner Träume, passt besonders gut zu Mays Charakter. Denn zum ersten Mal, so Helmut Schmiedt, »überwuchert die Phantasie sichtlich den Realitätsbezug, antwortet May auf die wirkliche Misere mit dem ernsthaften Versuch, zu ihrer Lösung den Trost der Fiktion heranzuziehen«.[33]
May selbst hat in ›Mein Leben und Streben‹, mit Bezug
auf die Spanien-Episode, klar erkannt: »Der Fehler lag daran, daß ich
infolge des verschlungenen Leseschundes den Roman für das Leben hielt und
darum das Leben nun einfach als Roman behandelte. Die überreiche
Phantasie, mit der mich die Natur begabte, machte die Möglichkeit dieser
Verwechslung zur Wirklichkeit.« (S. 92)
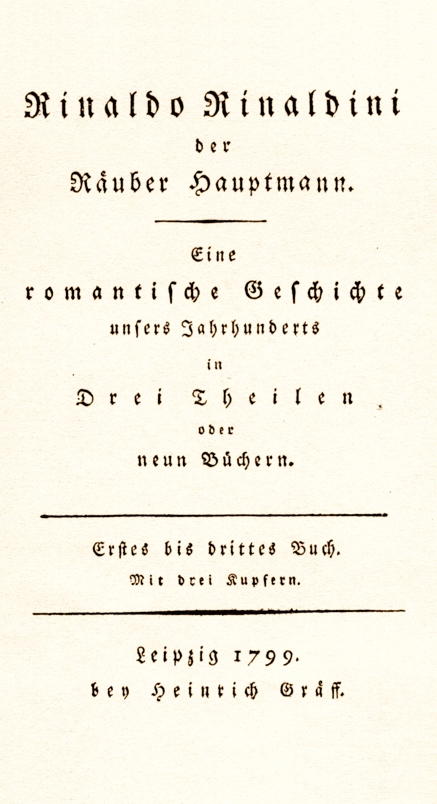 |
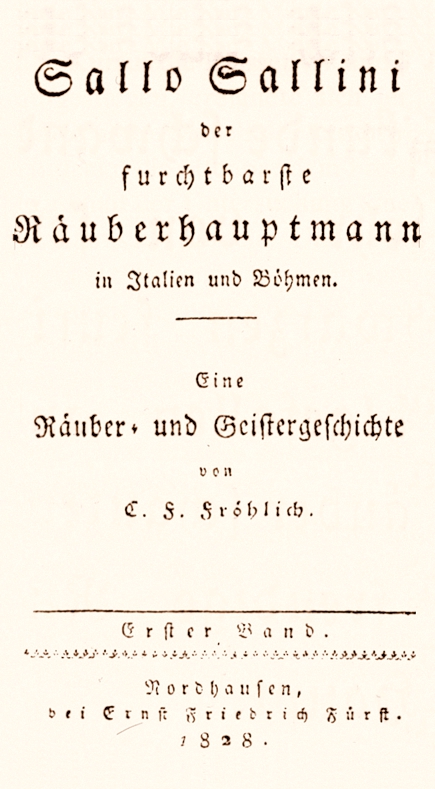 |
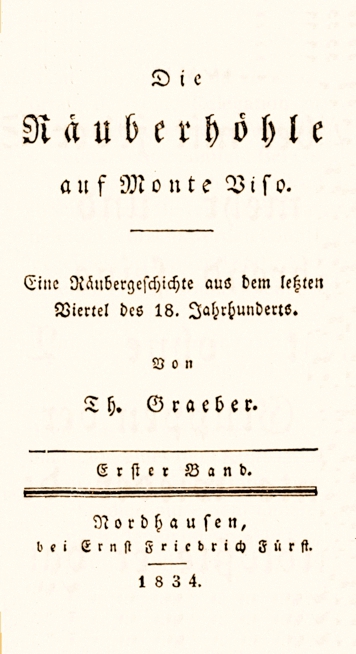 |
Archiv: Dr. Hainer Plaul.
15 Zur Straftäterzeit
Die »überreiche Phantasie«, mit der ihn »die Natur begabte«, ersetzte Karl
May in ›Mein Leben und Streben‹ sehr weitgehend durch eine sachliche, an
der Wirklichkeit orientierte Darstellung. Dies gilt mit gewissen
Einschränkungen – um ein markantes und viel diskutiertes Beispiel
aufzugreifen – auch für die Schilderung der Straftäterzeit in Mays
Selbstbiographie.
Diese Darstellung ist allerdings, aus verständlichen Gründen, sehr ungenau und sehr unvollständig. Alle seine Missetaten im einzelnen aufzuzählen, war May nicht bereit. Denn sein eigener »Henker, Schinder und Abdecker« (S. 169) wollte er – ich kann das verstehen – nicht sein.
Seine Schuld gestand May zwar grundsätzlich ein. Zugleich aber schrieb er in der Selbstbiographie, er sei in jener Zeit – in den 1860er Jahren – psychisch gestört gewesen und habe an Bewusstseinstrübungen gelitten: Es gab »Wochen, in denen es vollständig dunkel in mir wurde; da wußte ich kaum oder oft auch gar nicht, was ich tat. In solchen Zeiten war die lichte Gestalt in mir vollständig verschwunden. Das dunkle Wesen führte mich an der Hand. Es ging immerfort am Abgrund hin. Bald sollte ich dies, bald jenes tun, was doch verboten war. Ich wehrte mich zuletzt nur noch wie im Traum.« (S. 119)
Was ist von solchen Aussagen zu halten? So viel ist sicher: Derartige, Mays Strafmündigkeit einschränkende, Sätze in ›Mein Leben und Streben‹ sind keineswegs von vornherein unglaubwürdig. Mays Selbstpsychogramm für die Straftäter- und Vagantenjahre (S. 111ff. u. ö.) sollte also »nicht vorschnell verworfen werden«.[34] Diese behutsame Einschätzung durch den Strafrechtler Claus Roxin ist nach wie vor aktuell.
Bekanntlich hat May zur Beschreibung seines damaligen Seelenzustandes, mit einiger Wahrscheinlichkeit, das Lehrbuch ›Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten‹ (3. Auflage 1871) des Psychiaters Wilhelm Griesinger verwendet.[35] Wilhelm Griesinger (1817–1868) ist ein Mitbegründer der modernen Psychiatrie, der noch heute in der Fachliteratur viel zitiert und in medizingeschichtlichen Vorträgen oft erwähnt wird. Wenn Karl May das Standardwerk von Wilhelm Griesinger gelesen hat, so bestätigt dies zunächst einmal nur, dass er ein gebildeter Mensch war, der – auf vielen Gebieten – auf der Höhe des Wissens seiner Zeit stand.
Aus Mays Lektüre folgt aber nicht, dass er seine Darstellung einer eigenen Krankheitsphase – um sich selbst zu entlasten und um das Mitleid seiner Lesergemeinde zu erhaschen – frei erfunden und mit Hilfe des Griesinger-Buches wissenschaftlich verbrämt habe. Es kann auch sein (und dies scheint mir näherliegend), dass May die Griesinger-Thesen lediglich als Formulierungshilfen benutzt hat, um schwierige, für den Laien kaum verständliche Sachverhalte besser schildern zu können.[36]
16 Zur Problematik einer Differentialdiagnose
Nach meinen eigenen Erfahrungen in der psychiatrischen Seelsorge ist die
Annahme, der traumatisierte, höchstwahrscheinlich zu Unrecht aus dem
Dienst entlassene,[37] seiner beruflichen
Existenz beraubte Schullehrer Karl May habe in den 1860er Jahren unter
einer ernsthaften, seine Schuldfähigkeit beeinträchtigenden seelischen
Erkrankung gelitten, durchaus plausibel. Allerdings muss das noch lange
nicht heißen, dass es sich um eine manisch-depressive Psychose oder um
eine schwere Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis gehandelt hat.
Nein, eine derartige Krankheit ist im Falle Mays (aus Gründen, die oft
schon erörtert wurden) nahezu mit Sicherheit auszuschließen.[38]
Welche Diagnose kommt dann in Betracht? Diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Theoretisch denkbar sind mehrere Möglichkeiten. Jede Festlegung wäre spekulativ und anfechtbar. Eine exakte psychiatrische Differentialdiagnose des psychischen Zustands Karl Mays wäre schon in den 1860er Jahren ein sehr schwieriges – oder unmögliches – Unternehmen gewesen. Und heute, da der Delinquent ja nicht mehr befragt und untersucht werden kann, ist eine solche – Mays retrospektive Darstellung mit Sicherheit verifizierende oder falsifizierende – Diagnose natürlich vollends unmöglich.
Wir müssen ja grundsätzlich bedenken: Die forensische Psychiatrie ist ein sehr weites und überaus steiniges (um nicht zu sagen: vermintes) Feld! Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Depression und psychischer Krankheit. Und die Feststellung der vollen oder der – mehr oder weniger – verringerten Schuldfähigkeit eines Straftäters ist eine komplizierte, auch unter Experten oft umstrittene Sache.
Es kann jedenfalls sein, und ich halte dies für keineswegs unwahrscheinlich, dass May an einer vorübergehenden (und dennoch schwerwiegenden) Persönlichkeitsstörung gelitten hat,[39] die schon damals – mit entsprechender Menschenkenntnis – behandelbar war und tatsächlich während Mays Aufenthalt im Zuchthaus zu Waldheim (1870–1874) erfolgreich behandelt wurde: durch den – besonders einfühlsamen – katholischen Lehrer und Gefängniskatecheten Johannes Kochta, möglicherweise auch durch den jungen, der praktischen Psychiatrie zugewandten Anstaltsarzt Dr. Adolf Knecht.[40]
Es gibt psychische Defekte und seelische Krankheiten, die am besten durch menschliche Nähe, durch Verständnis und Zuwendung zu heilen (oder deutlich zu lindern) sind. Karl May wird solche Heilung in Waldheim erfahren haben. »Es liegt noch heut«, schrieb der Dichter, »eine unendliche Dankbarkeit für diese Wärme und diese Güte in mir, die sich meiner annahm und keinen einzigen Vorwurf für mich hatte, als alles Andere gegen mich war.« (S. 174)
Fest steht, dass May nach der Entlassung aus Waldheim nicht mehr rückfällig wurde, weder im strafrechtlichen noch im psychiatrischen Sinne (es sei denn, man würde das Old Shatterhand-Gehabe in den 1890er Jahren als psychiatrischen Fall bewerten). Doch wie schwer seine Erkrankung in den 1860er Jahren gewesen sein könnte und wie sie genauer zu klassifizieren ist, das lässt sich heute, aus besagten Gründen, nicht mehr klären.
17 Zur frühkindlichen Blindheit
Nach wie vor umstritten ist ferner – seit Johannes Zeilingers Publikation ›Autor in fabula‹ (2000) – die Frage, ob die in ›Mein Leben und Streben‹ geschilderte frühkindliche Erblindung Karl Mays in einem real-körperlichen oder nur in einem fiktional-›symbolischen‹ Sinne zu verstehen ist. Johannes Zeilinger nämlich hat medizinisch nachgewiesen, dass es eine Augenoperation des kleinen Karl nicht gegeben hat und eine mehrjährige Erblindung des Kindes, gleich nach der Geburt, völlig auszuschließen ist.[41]
In Mays Selbstbiographie steht jedoch geschrieben: »Ich habe in meiner Kindheit stundenlang still und regungslos gesessen und in die Dunkelheit meiner kranken Augen gestarrt […]. Ich sah nichts. Es gab für mich weder Gestalten noch Formen, noch Farben, weder Orte noch Ortsveränderungen. Ich konnte die Personen und Gegenstände wohl fühlen, hören, auch riechen; aber das genügte nicht, sie mir wahr und plastisch vorzustellen. Ich konnte sie mir nur denken. Wie ein Mensch, ein Hund, ein Tisch aussieht, das wußte ich nicht; ich konnte mir nur innerlich ein Bild davon machen, und dieses Bild war seelisch. Wenn jemand sprach, hörte ich nicht seinen Körper, sondern seine Seele. Nicht sein Aeußeres, sondern sein Inneres trat mir näher.« (S. 30f.)
Hat May mit diesen Worten, mit diesen eindrucksvollen Sätzen nicht die Wahrheit gesagt? Ist das blinde Kind eine Erfindung des »Hakawati« (S. 35), des »Märchenerzählers« (S. 136f.) Karl May? Wollte er sich insgeheim auf dieselbe Stufe stellen mit dem griechischen Mythenerzähler Homer, der ja ebenfalls, wie man sagt, blind gewesen ist? Wollte May sich als ›blinder Seher‹ stilisieren – analog zu Teiresias, dem blinden Propheten in der griechischen Mythologie, oder in Entsprechung zum Münedschi, dem blinden Visionär in Mays Reiseerzählung ›Am Jenseits‹ (1899)?
Oder wollte der kleine Karl – wie der Literaturwissenschaftler Thomas Kramer meint – ›nichts sehen‹, weil seine Kindheit so armselig war? Hat er vor der Realität im trostlosen Elternhaus die Augen verschlossen? Und folgte der spätere Autobiograph mit seiner Geschichte vom ›blinden‹ Kind, das dann ›innerlich‹ umso tiefer zu sehen vermochte, lediglich einem literarischen Topos: dem »Motiv der Überlegenheit innerer Wesensschau«,[42] einem Motiv, das ja auch sonst in der Dichtkunst oftmals zu finden ist, z. B. bei Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke?[43]
Konnte ›Karle‹ also immer sehen, wie jedes andere Kind? Wollte der geschmähte, öffentlich angegriffene Autor womöglich bei seinen Feinden bzw. Prozessgegnern – in einer Art captatio benevolentiae – ein Mitgefühl mit dem ehemals so armen, ja sogar blind gewesenen Kinde hervorrufen? Überzeugend finde ich keine dieser Theorien. Zumal Karl May ja schon in einem Privatbrief aus dem Jahre 1897 (als er noch überall bejubelt wurde und als es noch keinerlei Presseattacken gegen den ›meistgelesenen deutschen Schriftsteller‹ gab) seine frühkindliche Blindheit bekundet hatte.[44]
Nach meiner Auffassung ist Mays Blindheitsschilderung
in der Kernaussage plausibel und stimmig. Im Gegensatz zu Mays epischen
(autobiographisch zwar ebenfalls relevanten,[45]
aber eben doch fiktionalen) Werken enthält ›Mein Leben und Streben‹ derart
viele – verifizierbare und nachgewiesene – autobiographische Fakten, dass
ich nach gründlicher Abwägung des Pro und Kontra nicht einsehen kann,
warum ausgerechnet die Blindheitsschilderung fiktional sein sollte. Mays
Darstellung der frühkindlichen Blindheit ist von einer so eindringlichen
Intensität, einer so persönlichen Bewegtheit, dass ich eine reine
Erfindung der Blindheit durch Karl May hier ausschließen möchte. Hinzu
kommt, dass das Motiv der Blindheit und der Blindenheilung in Mays
literarischem Gesamtwerk einen so auffällig breiten Raum einnimmt,[46] dass sich die Annahme eines
realen biographischen Hintergrunds geradezu aufdrängt.
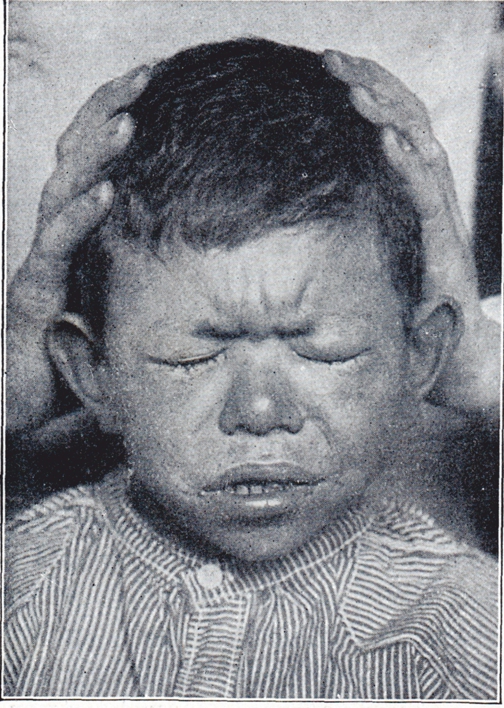
»Nach langdauerndem Lidkrampf kommt es sogar ab und zu vor, daß kleinere Kinder den Gebrauch ihres Sehens vollständig verlernen und trotz der Heilung mit wiedergeöffneten Augen wochenlang teilnahmslos dastehen und die Augen gar nicht gebrauchen (Amaurose [Erblindung ] nach Blepharospasmus). Dieser Zustand pflegt die Eltern sehr zu erschrecken, er geht aber sicher vorüber.«
Dr. Theodor Axenfeld (Hg ), Professor für Augenheilkunde in Freiburg i . Br: ›Lehrbuch der Augenheilkunde‹, Jena 1912 , S. 328f.
18 Der wahrscheinliche Sachverhalt
Zeilingers – von etlichen May-Forschern allzu bereitwillig übernommenen –
Argumente gegen eine frühkindliche Erblindung Karl Mays sind keineswegs
zwingend. Augenmedizinische Erkenntnisse, die der Meinung Zeilingers
entgegenstehen und die Darstellung Mays (indirekt) bestätigen, gibt es
sehr wohl.[47] Nur werden diese Erkenntnisse
in der aktuellen Sekundärliteratur zu Karl May fast durchwegs ignoriert
oder zu wenig beachtet.
Welche Umstände also könnten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zur Erblindung und später zur Heilung des kleinen Karl geführt haben? Wenn man die Darstellung Karl Mays in ›Mein Leben und Streben‹ genau liest, ist zu bemerken: Von einer (in Zeilingers Untersuchung mit Recht für unmöglich erklärten) Augen-Operation ist dort gar nicht die Rede, auch nicht von einer Erblindung unmittelbar nach der Geburt.
In den ersten Monaten seines Lebens kann Karl nicht erblindet sein. Anfänglich muss sein Sehvermögen sich normal entwickelt haben. Der visuelle Input, die unerlässliche Verbindung zwischen den Augen und dem Sehzentrum in der Hirnrinde, musste aufgebaut worden sein. Denn andernfalls wäre May auch später nie in der Lage gewesen, stereoskopisch – also ohne nennenswerte Einschränkung – zu sehen.
Karl May schrieb aber wörtlich, dass er »kurz nach der Geburt sehr schwer erkrankte, das Augenlicht verlor und volle vier Jahre siechte« (S. 16). Diesen eigenartigen Satzbau in Mays Selbstbiographie kann man auch so verstehen: Die Formulierung »kurz nach der Geburt« bezieht sich auf eine allgemeine Erkrankung, nicht aber auf den Verlust des Augenlichts. Die Aussage wäre dann: Sehr früh schon »siechte« das Kind wegen einer schweren, vielleicht rachitischen Krankheit,[48] bedingt durch starke Unterernährung; und irgendwann im frühkindlichen Alter konnte Karl (vermutlich aufgrund eines Lidverschlusses) nicht mehr sehen; er litt also zeitweilig an ›funktioneller‹ Blindheit. Später jedoch, nach der sachkundigen Behandlung (nicht nach einer Operation!) durch die Dresdener Ärzte Dr. Carl Haase und Dr. Woldemar Grenser, lernte der kleine Karl wieder das Sehen.[49]
Auch wenn die Erblindung, wie anzunehmen ist, nur wenige Monate gedauert hat, sind Mays Ausführungen in ›Mein Leben und Streben‹ durchaus korrekt. Ja selbst wenn Karl May – in seiner doppeldeutigen Aussagenreihe (S. 16) – tatsächlich hätte sagen wollen, er habe »kurz nach der Geburt« das Augenlicht verloren, so wäre ihm dies nicht als ›Falschaussage‹ und nicht als ›Mythenbildung‹ anzurechnen. Denn niemand kann sich an die ersten beiden Lebensjahre erinnern. Wie lange er als Kind erblindet war, das konnte May ja gar nicht wissen und darüber gibt es in ›Mein Leben und Streben‹ auch keine exakte Angabe.[50]
Mit Ralf Harder bin ich deshalb der Meinung: Karl Mays Erblindung als kleines Kind ist keine »Legende«, kein Phantasieprodukt des späteren Dichters, sondern ein realer biographischer Sachverhalt.[51]
Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass man die
frühkindliche Erblindung Karl Mays, unbeschadet des
medizinisch-körperlichen Aspekts, zugleich auch ›symbolisch‹
verstehen könnte: als Bild für ein außersinnliches ›Schauen‹, als Metapher
für ein tieferes, die Oberfläche der Dinge durchdringendes
Wahrnehmungsvermögen.
19 Mays Hang zur Symbolik
»Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.«[52] Zu dieser Einsicht des
›Kleinen Prinzen‹ könnte May schon sehr früh gekommen sein. Man kann
sagen: Er hat es als Kind schon gelernt, das Leben ›mit anderen Augen‹ zu
sehen – mit den Augen des Inneren, der Seele, der schöpferischen
Einbildungskraft. In sinnbildlicher, ›symbolischer‹ Bedeutung schrieb er
in der Selbstbiographie (S. 31):
»Es gab für mich nur Seelen, nichts als Seelen. Und so ist es geblieben, auch als ich sehen gelernt hatte, von Jugend an bis auf den heutigen Tag. […] Das ist der Schlüssel zu meinen Büchern. […] Nur wer blind gewesen ist und wieder sehend wurde, und nur wer eine so tief gegründete und so mächtige Innenwelt besaß, daß sie selbst dann, als er sehend wurde, für lebenslang seine ganze Außenwelt beherrschte, nur der kann sich in alles hineindenken, was ich plante, was ich tat und was ich schrieb […]!«
Karl May war – darin sind sich alle, die Freunde wie die Gegner, einig – ein äußerst phantasiebegabter Mensch, ein Autor mit einer »mächtigen Innenwelt«. Dementsprechend geht es in seinem Erzählwerk oft sehr phantastisch und nicht wirklich ›mit rechten Dingen‹ zu.
Mays literarisches Spätwerk freilich ist
nicht nur ›phantastisch‹, es ist – mit seinen transzendenten, die
sinnliche Wahrnehmung überschreitenden Traumwelten – eine höchst
kunstvolle, streckenweise mystische, insgesamt symbolisch-allegorische
Dichtung. Vor allem sein fast unbekanntes Erlösungsdrama ›Babel und Bibel‹
(1906) sowie seine als schwer lesbar geltenden Altersromane ›Im Reiche des
silbernen Löwen III/IV‹ (1902/03), ›Ardistan und Dschinnistan‹ (1907/09)
und ›Winnetou IV‹ (1909/10) sind zweifelsfrei symbolisch zu
verstehen. In ›Mein Leben und Streben‹ nun aber behauptet May, auch seine
früheren ›Reiseerzählungen‹ (die berühmten Abenteuerromane ›Durch die
Wüste‹, ›Durchs wilde Kurdistan‹, ›Winnetou I-III‹, ›Satan und Ischariot
I-III‹ usw.) seien gleichnishaft und »symbolisch« gemeint: als ›Reisen‹
ins Innere der »Menschheitsseele«, als Vorentwürfe der späteren,
symbolistischen, geistig aufwärts strebenden Poesie.
20 Die klassischen ›Reiseerzählungen‹
In einem essayistischen, erst kürzlich erschienenen ›Karl-May-Porträt‹ ist
zu lesen: Der späte May »ordnet und deutet die Geschichte seines Lebens
und seiner Texte neu und stellt sie in einen großen, neuerfundenen
Sinnzusammenhang, einen Mythenkosmos«.[53]
Ich könnte dieser Bemerkung zustimmen, mit zwei wichtigen Einschränkungen
allerdings: Zum einen würde ich nicht von »neuerfundenen«, sondern von neu
erkannten Zusammenhängen sprechen. Und zum anderen halte ich die
Bezeichnung »Mythenkosmos«, im Blick auf die Selbstbiographie ›Mein Leben
und Streben‹, für unpassend.
Die Frage, auf die es hier ankommt, ist doch: Trifft Mays nachträgliche Interpretation seiner ›Reiseerzählungen‹ (ab 1881) zu? In gewisser Weise, so meine ich, ja! »Symbolisch« sind Mays frühere ›Reiseerzählungen‹ insofern zu verstehen als – wie Heinz Stolte, Claus Roxin und, besonders eingehend, Walther Ilmer gezeigt haben[54] – in vielschichtiger (dem Autor während des Schreibprozesses vielleicht nur teilweise bewusster) Verschlüsselungstechnik tatsächliche Ereignisse aus dem Leben Karl Mays zur Darstellung kommen – verfremdet im exotischen Gewand.
In ›Mein Leben und Streben‹ schreibt May, durchaus zu Recht und sehr treffend: »Ich hatte meine Sujets aus meinem eigenen Leben, aus dem Leben meiner Umgebung, meiner Heimat zu nehmen und konnte darum stets der Wahrheit gemäß behaupten, daß Alles, was ich erzähle, Selbsterlebtes und Miterlebtes sei. Aber ich mußte diese Sujets hinaus in ferne Länder und zu fernen Völkern versetzen, um ihnen diejenige Wirkung zu verleihen, die sie in der heimatlichen Kleidung nicht besitzen.« (S. 139)
Als ›Seelenprotokolle‹ also spiegeln die ›Reiseerzählungen‹ (wie auch die Kolportageromane ›Waldröschen‹, ›Die Liebe des Ulanen‹, ›Der verlorne Sohn‹ usw.) das ›Leben und Streben‹ des Schriftstellers. Und sofern sie viel ›archetypisches‹ Material enthalten, entsprechen sie auch den Sehnsüchten vieler Leser/innen, ja den Träumen der »Menschheitsseele«.
Man könnte zum Beispiel sagen: Die Landschaftsbeschreibungen in Mays klassischen Abenteuerromanen, ihre Wüsten und Seen, ihre Oasen und Höhlen, ihre Schluchten und Talkessel, ihre Tiefebenen und Bergeshöhen sind – nicht selten – Metaphern. Sie stehen, in vielen Romanpartien, ›symbolisch‹ für die ›Seelenlandschaften‹ des »kollektiven Unbewussten« (C. G. Jung). Man kann durchaus sagen: Mays Bücher sprechen »von Seele zu Seele«;[55] sie dringen ins Unbewusste, in die Innenbezirke des Lesers ein. Auch insofern sind sie ›symbolische‹, die abenteuerliche Handlung überschreitende Schriften.[56]
Überdies bemerkt May in ›Mein Leben und Streben‹ (S.
144 u. 209), er habe seine Lesergemeinde schon in frühesten Erzählungen
auf die geistigen und ethischen Höhen von »Dschinnistan« gewissermaßen
vorbereiten wollen. Eine haltlose Behauptung? Nicht unbedingt, man muss
differenzieren!
Es ist zwar höchst unwahrscheinlich, dass May seine symbolistische,
utopisch-mystische Alterspoesie (mit Marah Durimeh, der barmherzigen
›Urmutter‹, der weisen und mächtigen ›Himmelskönigin‹, sowie mit Winnetou,
dem bekennenden Christen, dem gewaltlosen und jesus-ähnlichen
›Edelmenschen‹, als Protagonisten) schon zu Beginn seines literarischen
Schaffens bewusst geplant habe. So gesehen dürfte sich May in der
Rückschau – in einer für Selbstbiographien typischen
Erinnerungsverschiebung oder Wahrnehmungsverzerrung[57]
– geirrt haben.
Aber es ist andererseits ja nicht zu bestreiten: Der
letztliche Sieg des Guten über das Böse, der Liebe über den Hass, des
»Edelmenschen« über den »Gewaltmenschen« zieht sich wie ein roter Faden
(wenn auch in unterschiedlicher Deutlichkeit) durch Karl Mays Gesamtwerk:
von den ›Geographischen Predigten‹ und dem ›Buch der Liebe‹ (1875) bis hin
zu ›Ardistan und Dschinnistan‹ und ›Winnetou IV‹. So gesehen hat May ja
nicht Unrecht, wenn er eine inhaltliche Kohärenz in den Früh- und den
Spätwerken herausstellt (wobei diese innere Einheit im Werk, diese
Kontinuität in der humanitären Ausrichtung und in der moralischen
Grundtendenz, freilich nicht in allen Schriften konsequent und
bruchlos durchgehalten wird[58]).
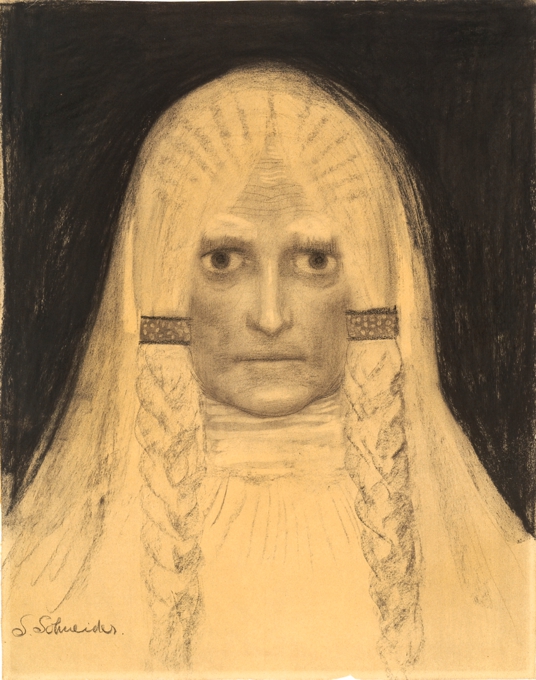
Marah Durimeh von Sascha Schneider. Archiv:
Karl-May-Stiftung.
21 Das erzählende »Ich«
Retrospektiv wird Mays literarisches Werk in der Selbstbiographie, in
wesentlichen Punkten, richtig gedeutet. Darüber hinaus aber verblüfft die
Selbstbiographie mit der Erklärung: Auch das erzählende »Ich«, der
Edelmensch Old Shatterhand/Kara Ben Nemsi, sei – schon in den
›Reiseerzählungen‹ der 1880er und 1890er Jahre – keine reale Person,
vielmehr eine Allegorie für die »Menschheitsfrage«, d. h. für die Frage
nach dem Wesen und dem Ziel des menschlichen Daseins. Das Roman-»Ich«,
versicherte May, sei gar nicht er selbst, sondern die künftige, noch nicht
erreichte Gestalt seines Ich und des Menschen überhaupt.
Mays literarisches »Ich«, so heißt es in ›Mein Leben und Streben‹, sei
»keine Wirklichkeit, sondern dichterische Imagination. Doch, wenn dieses
›Ich‹ auch nicht selbst existiert, so soll doch Alles, was von ihm erzählt
wird, aus der Wirklichkeit geschöpft sein und zur Wirklichkeit werden.
Dieser Old Shatterhand und dieser Kara Ben Nemsi, also dieses ›Ich‹ ist
als jene große Menschheitsfrage gedacht, welche von Gott selbst geschaffen
wurde, als er durch das Paradies ging, um zu fragen: ›Adam, d. i. Mensch,
wo bist du?‹ ›Edelmensch, wo bist du?‹« (S. 144)
Natürlich klingt diese Erklärung mysteriös, nachgeschoben und ausredenhaft
– wenn man bedenkt, dass der Schriftsteller in den 1890er Jahren in aller
Öffentlichkeit, in Show-Veranstaltungen großen Stils, die Identität des
Autors Karl May mit dem Romanhelden Old Shatterhand/Kara Ben Nemsi
genüsslich demonstriert hatte. Diese fatale, diese törichte und
verhängnisvolle »Old Shatterhand-Legende« (Claus Roxin)[59]
wurde um die Jahrhundertwende enttarnt, und Karl May wurde von – zum Teil
böswilligen – Enthüllungsjournalisten aufs grausamste bloßgestellt bzw.
verleumdet: als »geborener Verbrecher«, als ehemaliger Zuchthäusler und
späterer »Schund«-Produzent, als »Verderber der Jugend«, als notorischer
Lügner und Betrüger. Da liegt es schon nahe zu meinen: Karl Mays
nachträgliche Interpretation des literarischen »Ich« sei eine Ausrede oder
bestenfalls eine Selbsttäuschung des gedemütigten Autors.
22 Schein und Sein
Gleichwohl ist Mays neue Deutung im wesentlichen richtig. So unscharf, so
verlegen, so rätselhaft die Rede von der »Menschheitsfrage« auch sein mag,
an einen großen Traum, an eine ›menschheitliche‹ Sehnsucht rührt das »Ich«
der Mayschen ›Reiseerzählungen‹ doch. Es hat – wie ich an anderer Stelle
schrieb – eine magische Kraft, »die den Autor (ebenso wie den Leser) über
sein jetziges Ich hinausruft. Das Wunsch-Ich des Dichters fordert ein
Ahnen, ein Sehnen heraus, das sich mit der Welt des Faktischen nicht
weiterhin abspeisen lässt, das die Gegenwart mit ihren Grenzen, ihrer
Verengungen, ihrem Stückwerk und ihrem Versagen als vorläufig und
überwindbar durchschaut.«[60]
Karl May hat, aus meiner Sicht, sich selbst und seine Werke im Nachhinein weit besser verstanden als in den Erfolgszeiten der 1890er Jahre. Gewiss ist der große Held Old Shatterhand/Kara Ben Nemsi eine literarische Erfindung. Und der »Edelmensch« des Spätwerks ist zweifellos eine Utopie, eine Imagination. Aber spricht dies gegen den Autor Karl May und gegen den Wahrheitsgehalt der Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹?
Mir ist folgender – in der May-Forschung noch wenig beachteter – Gedanke sehr wichtig: Könnte die Fiktion, der vorläufige Schein, das spielerische ›Als ob‹ nicht – in einem menschlichen Reifungs- und Läuterungsprozess – am Ende noch hinführen zum wirklichen Sein? Gemäß dem Goethe-Wort »So laßt mich scheinen, bis ich werde«?[61]
Ich frage mich im Blick auf Karl May – und ebenso im
Blick auf mich selbst und auf das Menschsein überhaupt: Birgt die positiv,
als kreative Energie verstandene Fiktionalität von Lebensentwürfen nicht
ein Hoffnungspotenzial, das dem Leben Flügel verleiht? Ist dieser
psychologische, aber auch philosophisch-metaphysische Gedanke – einer
möglichen Entwicklung vom Schein zum Sein, von der Utopie zur
Wirklichkeit, vom Wunschtraum zur erfüllten Realität – nicht in der Tat
eine »Menschheitsfrage«, eine Kernfrage des menschlichen
Daseinsverständnisses?

Karl May als Old Shatterhand: Törichte
Maskerade, aber auch gewinnbringende Selbstvermarktung.
23 »Das Karl May-Problem ist das
Menschheitsproblem«
Mays Autobiographie enthält das grandiose, oft bespöttelte Diktum »Das
Karl May-Problem ist das Menschheitsproblem, aus dem großen, alles
umfassenden Plural in den Singular, in die einzelne Individualität
transponiert.« (S. 12) Natürlich könnten wir in diesem sonderbaren,
bombastisch klingenden Satz – bei oberflächlicher Betrachtung – eine
abstruse, eine nur lächerliche Selbstüberschätzung des Autors sehen. Bei
genauerem Hinschauen aber kann man doch sagen: Dieser Satz enthält eine
Wahrheit. Denn das »Karl May-Problem« berührt das allgemeine
»Menschheitsproblem« sehr eng.
Mir jedenfalls ist es wiederholt so ergangen: Die intensive Beschäftigung mit der Biographie Karl Mays, die Auseinandersetzung mit der tragischen, in vielfacher Hinsicht gebrochenen Lebensgeschichte dieses außergewöhnlichen Menschen führte – in exemplarischer Deutlichkeit – zu all jenen Fragen und Problemen, die sich auch sonst bei der Rückbesinnung auf das menschliche Dasein ergeben.
»Das Karl May-Problem ist das Menschheitsproblem […].« Mit dieser zugespitzten Bemerkung macht sich der Autor nicht zum Mittelpunkt der Welt und nicht zum Maß aller Dinge. Karl May stellt sich hier nicht über andere Menschen, im Gegenteil: Er begreift sich selbst als Teil eines größeren Ganzen, eines umgreifenden Weltgefüges, eines ›menschheitlichen‹ Zusammenhangs.
Es sind in der Tat die großen »Menschheitsfragen«, es sind die zeitlosen »Menschheitsprobleme«, die in ›Mein Leben und Streben‹ immer wieder mit anklingen: Wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir?[62] Dahinter stehen die Existenz-Fragen: Wozu bin ich da? Wo will ich hin, welche Werte will ich realisieren, welche Aufgaben möchte ich künftig erfüllen, welche Ziele will ich am Ende erreichen?
Die Zielrichtung des menschlichen Strebens ist mit der großen Frage verknüpft: Wohin will es mit uns hinaus? Was ist unsere letzte Bestimmung? Welche Bedeutung kommt den Verfehlungen, den Irrwegen, den Brüchen, den Umwegen zu? Was ist Schuld und was nicht? Können wir qualvolle Schuld und schuldlose Qual immer so genau unterscheiden? Wie wird das enden, wohin führt der Kampf zwischen »Ardistan« und »Dschinnistan«, zwischen den finsteren und den lichtvollen Anteilen im Innern der Welt und im Herzen jedes einzelnen Menschen?
Alle diese Fragen hängen aufs engste mit dem »Karl
May-Problem« zusammen und, darüber hinaus, mit dem »Menschheitsproblem«
insgesamt.
24 Die großen Menschheitsthemen
Zu den großen Menschheitsthemen gehören – neben Unrecht und Leid, neben
Schuld und Sühne, neben Freiheit und Notwendigkeit, neben Liebe und Tod –
auch die vielen, äußeren und inneren, Konflikte, ohne die unser
Erdenleben kaum denkbar wäre.
Wie ist das eigentlich – frage ich mich bei der Lektüre von ›Mein Leben und Streben‹ – mit der »Spaltung des menschlichen Innern« (S. 177), dem Zwiespalt zwischen Gut und Böse, Liebe und Selbstsucht, Wahrheit und Trug? Welche Kräfte werden sich durchsetzen? Gibt es – wie May ja voraussetzte – schon jetzt eine Vorahnung, eine Antizipation von künftigem Heil? Wie verhalten sich (vorläufiges) Sein und (kreativer) Schein, wie verhalten sich Realität und Imagination zueinander?
Die großen Menschheitsthemen beschränken sich nicht auf die jetzige und nicht auf die diesseitige Welt. Es läuft bei Karl May auf die Fragen hinaus: Muss »Dschinnistan«, muss das ›Reich Gottes‹ für immer eine Utopie bleiben? Wo berühren sich – schon heute – Erde und Himmel, Diesseits und Jenseits, schmerzliche Sehnsucht und letzte Erfüllung? Was wird am Ende auf uns zukommen? Der Abgrund des Nichts oder die lichten Höhen von »Dschinnistan«?
Wird die Menschheit, wird die Einzelperson sich weiterentwickeln – nach ›oben‹? Gibt es eine Liebe, eine unendliche Liebe, die größer ist als die Schuld und die stärker ist als der Tod?[63] Das sind die Fragen, das sind die »Menschheitsprobleme«, um die es in ›Mein Leben und Streben‹ – wie überhaupt bei Karl May – im wesentlichen geht.
Mays Selbstbiographie hat folglich einen sehr weiten, ja einen unendlichen Horizont. Neben sehr irdischen Dingen hatte May in ›Mein Leben und Streben‹ stets auch den Himmel im Blick: die ›ewigen‹ Dinge, die über ein »nur materielles Dasein« (S. 317), also über das Sichtbare und Greifbare, hinausweisen – ins rein Geistige und ins jenseitig Göttliche.
Gerade auch insofern geht es in dieser Autobiographie nicht ausschließlich um die Einzelperson Karl May. Vielmehr geht es, weit über das »May-Problem« hinaus, um die große »Menschheitsfrage« nach einem letzten Sinn des Daseins überhaupt – und somit um die Frage nach einem »Leben in Fülle«,[64] nach einem Leben, das im Tod nicht erlischt, das vielmehr jenseits des Todes sein eigentliches Ziel, die Vollendung, die Glückseligkeit erreicht.
Ob es – im Sinne der neutestamentlichen Botschaft –
ein vollkommenes Glück, ein individuelles Fortleben in der Herrlichkeit
Gottes, eine jenseitige Erfüllung der tiefsten menschlichen Sehnsucht in
Wirklichkeit gibt (bzw. geben wird), ist allerdings keine Frage der
empirischen Forschung, sondern eine Frage des persönlichen Vertrauens, der
existenziellen Glaubensentscheidung. Dass Karl May diese Entscheidung aus
wirklicher Überzeugung (und nicht nur aus opportunistischen
Gründen) getroffen hat, steht für mich außer Frage.
25 Mays persönlicher Reifungsweg
Ich komme zu einer ersten Bilanz: Bei allen Besonderheiten, ja
Skurrilitäten (besonders in den 1890er Jahren) ist Karl May für mich ein
exemplarischer Mensch, ein Inbild der Suche nach immer besseren
Daseinsentwürfen. Dieser Mann stand oft vor dem Abgrund, vor dem
beruflichen und persönlichen ›Aus‹. Er hat zwar viele, zum Teil auch
schwerwiegende, Fehler gemacht. Aber er hat sich nie aufgegeben, er hat zu
sich selbst immer wieder gefunden. Der Mensch wie der Schriftsteller Karl
May hat sich – von Krise zu Krise - innerlich erneuert, er ist
(unbeschadet mancher Rückschläge) gereift und gewachsen.
Was ich an Karl May seit langem bewundere, ist nicht zuletzt sein komplizierter, verwickelter Werdegang: Über viele Um- und Irrwege entwickelte sich May vom vielfach geschädigten Kind und vom psychisch gestörten Straftäter zum angesehenen Autor, vom talentierten Jugend- und Abenteuerschriftsteller zum religiösen Symboldichter und Verfasser eines literarisch bedeutenden Spätwerks.
Dieser Entwicklungsweg fand im Spätwerksroman ›Ardistan und Dschinnistan‹, aber auch – in ganz anderer Weise - in der Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹ ihre höchste und ihre wahrhaftigste Ausdrucksform. Der, mit May persönlich bekannte, Anthropologe und Sexualforscher Friedrich Salomo Krauss (1859–1938) war sogar der Meinung: Hätte Karl May nur dieses eine Buch ›Mein Leben und Streben‹ geschrieben, »so verdiente er schon daraufhin den Namen eines unserer größten, unserer ehrlichsten Schriftsteller«.[65]
Wie May selbst am 8. Mai 1910 in einem Brief an seinen Verleger F. E. Fehsenfeld formulierte, ist ›Mein Leben und Streben‹ »das wichtigste und ernsteste Buch, welches ich jemals geschrieben habe«.[66] Jedenfalls ist mit Fug und Recht zu konstatieren: Im Vergleich zu Mays peinlicher Selbstinszenierung in den 1890er Jahren ist ›Mein Leben und Streben‹ ein geistiger Fortschritt, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Warum also sollten wir May nicht zugestehen, dass er
aus den Fehlern der Vergangenheit sehr vieles gelernt hat, dass er die
Fähigkeit hatte, sich erheblich weiterzuentwickeln und über sich selbst
weit hinauszuwachsen? Und warum sollten wir ihm nicht zutrauen, dass sein
Reifungsweg auch im Jahre 1910 noch längst nicht zu Ende war? Und warum
sollten wir ihm nicht glauben, dass er – als Christ, als homo religiosus –
offen blieb für noch größere Ziele: für Ziele, die erst in
»Dschinnistan«, d. h. in einer anderen, transzendenten, himmlischen
Welt zu erreichen sind?[67]
26 Die Wahrheitsfindung im Werdeprozess
Karl May – der Autor des Frühwerks wie der Autor des Spätwerks – war ein
leidenschaftlicher Verfechter des Entwicklungsgedankens: im Blick auf den
Kosmos und im Blick auf die individuelle Person.[68]
»Ich bin ja mit mir selbst«, schrieb er in der Autobiographie, »noch nicht
fertig, bin ein Werdender. Es ist in mir noch Alles in Vorwärtsbewegung
[…]. Ich kenne mein Ziel; aber bis ich es erreicht habe, bin ich noch
unterwegs, und alle meine Gedanken sind noch unterwegs.« (S. 229)
Mays Lebenseinstellung, aber auch sein Wahrheitsbegriff hatten einen ›futuristischen‹, ›evolutionären‹ Aspekt: Die ganze, die unverhüllte Wahrheit wird offenbar werden in einem Entwicklungsprozess. Mit Bezug auf die aktuelle Pressekampagne und mit Bezug auf den versteckten Wahrheitsgehalt der Märchen – wie auch der eigenen ›Reiseerzählungen‹ und der gesamten eigenen Vita – schrieb Karl May in der Selbstbiographie: »[…] wie jedes echte Märchen doch endlich einmal zur Wahrheit wird, so wird auch alles an mir zur Wahrheit werden, und was man mir heut nicht glaubt, das wird man morgen glauben lernen.« (S. 141)
Dass die bekannten Volks- und Kunstmärchen eine tiefe innere Wahrheit enthalten, hat die tiefenpsychologische Forschung inzwischen begriffen. Darüber hinaus aber meinte der »Märchenerzähler« (S. 136f.) Karl May noch etwas anderes, etwas Philosophisches, Erkenntnistheoretisches: Nicht die Wahrheit an sich, so dachte May, wohl aber die volle Erkenntnis der Wahrheit liegt in der Zukunft, ja in der absoluten Zukunft Gottes.
Menschliches Erkennen bleibt in dieser Welt immer bruchstückhaft. Zwar lassen sich einzelne Begebenheiten und vordergründige Sachverhalte (wie z. B. die Straftaten des jungen Karl May) in vielen Details relativ einfach und relativ schnell herausfinden. Aber das Leben besteht ja nicht nur aus äußeren Fakten und datierbaren Ereignissen. Gerade das Wesentliche entzieht sich, wenn es um Menschliches geht, dem forschenden Zugriff und dem sicheren Wissen. Jedenfalls lassen sich tiefer gehende Fragen und hintergründige Wirklichkeiten (z. B. die wahren Beweggründe eines Menschen, die mit seiner psychischen Grundverfasstheit zusammenhängen, möglicherweise auch mit vorübergehenden Zwängen) oft nur sehr unzureichend erklären.
Rätselhaft bleibt vieles, gerade auch die Herzmitte des menschlichen Existierens. Prinzipiell nur vorläufig zu beantworten ist vor allem die Frage: Was bewegt mich wirklich, wer bin ich in meinem innersten Wesen? Karl May ging davon aus: Die Wahrheit wird sich prozesshaft als solche erweisen – zumal jede einzelne Person und die Wirklichkeit insgesamt noch im Werden sind.
Ich bin mir sicher: May suchte die Wahrheit – die vollständige Wahrheit auch des eigenen ›Lebens und Strebens‹. Er wollte diese Wahrheit klar und ungeschminkt sehen. Dabei war er überzeugt: Auch seine Gegner würden später erkennen, dass er in ›Mein Leben und Streben‹ – so weit es ihm möglich war – seine Lebensgeschichte und seine Lebensziele zutreffend geschildert hat.
Gleichzeitig war ihm bewusst: Hier auf Erden kann die Wahrheit immer nur annäherungsweise erkannt werden. Die umfassende Wahrheitsfindung ist ein Prozess, der über das irdische Dasein hinausreicht – in die Jenseitigkeit Gottes hinein. So wie May selbst »ein Werdender« (S. 229) ist, so wird sich die ganze, die endgültige Wahrheit der Schöpfung und aller individuellen Lebensgeschichten erst am Ende enthüllen.
27 Entwicklung und Ziel
Wie oben vermerkt, war Karl May begeistert von der Entwicklungsidee. Schon
vierzig Jahre vor der Niederschrift der Selbstbiographie notierte er,
anspielend auf die darwinistische Lehre, im Textfragment ›Ange et Diable‹
(1870):
»Es geht ein großer Gedanke durch die ganze Schöpfung, die ganze Welt, die ganze Menschheit: der Gedanke der Entwickelung.«[69]
Im allgemeinen, philosophischen, Entwicklungsgedanken bzw. in der speziell naturwissenschaftlichen Evolutionstheorie sah May nun freilich – wie ›Das Buch der Liebe‹ und spätere Schriften erhellen – keinen Widerspruch zum biblischen Schöpfungsglauben.[70] Für May gab es keinen Zweifel, dass ein persönlicher, liebender Gott die schöpferische Urkraft sei, die die Evolution des Universums und die Entwicklung des menschlichen Individuums bewirkt und vorantreibt.
Eine so aufgefasste – zielgerichtete – Entwicklungsidee, die das Leben in einer evolutionären Welt nicht durch blinde Zufälle, sondern durch göttliches Wollen bedingt sieht, hat natürlich erhebliche Konsequenzen für das allgemeine Lebensgefühl und für das Menschenbild: Bei aller Selbstständigkeit, bei aller Eigenverantwortung ist der Mensch nicht einfach nur sich selbst überlassen, sondern er bleibt getragen von Gottes Interesse und Zuwendung.
Mays Fortschrittsoptimismus hatte einen zutiefst religiösen Charakter. So stand er auch nicht unter dem schrecklichen Leistungsdruck, unentwegt der ›Schöpfer‹ oder der ›Erfinder‹ seines eigenen Lebens sein zu müssen. Vielmehr verstand Karl May sein Dasein und überhaupt die menschliche Existenz – dem Menschenbild der metaphysischen Philosophie bzw. der monotheistischen Religionen entsprechend – als von Anfang an ›verdankte‹, als von Gott geschenkte Existenz.
Dem geneigten Leser, dem aufmerksamen Betrachter wird es nicht entgehen: Der Wahrheitsanspruch in ›Mein Leben und Streben‹ hat, über autobiographische Fakten und lebensgeschichtliche Einzelheiten hinaus, eine spirituelle und universale Dimension. Gottes Schöpfergeist, so sah es May, will uns alle – durch, oft lange und umständliche, Entwicklungsprozesse hindurch – zum vollen Leben und zur ganzen Wahrheit führen.[71]
Nach christlicher Auffassung, und nach der Auffassung Karl Mays, ist Gott der Grund und das Ziel sowohl der kosmischen Evolution als auch des individuellen ›Lebens und Strebens‹ – gemäß dem großen, von May schon im ›Buch der Liebe‹ zitierten Augustinus-Wort: »Du hast uns auf dich hin erschaffen, o Gott, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.«[72] Mays selbstbiographische Aussage »Ich kenne mein Ziel« (S. 229) lässt sich also nicht trennen von Gott und von der existenziellen Sehnsucht nach Gott – nach dem persönlichen Gott, der, wie es im Evangelium heißt, »der Weg, die Wahrheit und das Leben«[73] ist.
Mays vorläufiges, nicht mehr erreichtes Ziel war zwar – neben dem Wunsch, die Gerichtsprozesse definitiv zu gewinnen – das Schreiben von noch weiteren, noch besseren literarischen Werken. Sein letztes und eigentliches Ziel aber war der »Himmel« (S. 320), die unvergängliche Liebe Gottes. So schließt ›Mein Leben und Streben‹ mit einem anrührenden Gedicht - »Nach meines Lebens schwerem Arbeitstag« (S. 320) –, in welchem der Autor sich selbst und sein gesamtes Lebenswerk »in Gottes Hände« legt.
Als Heimkehr zu Gott und somit als Erfüllung des irdischen ›Lebens und Strebens‹ hatte Karl May den Tod schon immer verstanden.[74] Speziell im oben genannten Gedicht verstand er das eigene Sterben als »Erlösung«, als unwiderrufliche Befreiung, als endgültige Entlassung aus der Gefangenschaft Ardistans. In dieser Hinsicht muss ich der jüngsten Deutung der Mayschen Selbstbiographie durch Hainer Plaul widersprechen bzw. sie modifizieren: Letztlich läuft Mays Ethik keineswegs – wie Plaul suggeriert – auf eine Selbsterlösung hinaus,[75] sondern auf die Erlösung des Menschen durch eine transzendente Instanz, d. h. durch eine weltüberschreitende Macht. Zwar hat die individuelle Person in der Sicht Karl Mays durchaus eine echte Mitverantwortung für die Weiter- und Höherentwicklung der Schöpfung und für die Entwicklung des persönlichen Selbst. Aber der Mensch muss sich eben nicht »am eigenen Schopfe aus dem Sumpfe« (Plaul)[76] ziehen. Vielmehr hoffte der Dichter auf Erlösung durch Gott als dem Ursprung und dem Ziel des menschlichen ›Lebens und Strebens‹.
Seinen bevorstehenden Tod verstand Karl May als Durchgang zum eigentlichen Ziel, als – von »des Meisters Spruch« erhofften – Aufstieg nach Dschinnistan. Das oben erwähnte Gedicht, und hiermit die Selbstbiographie, endet mit den Versen:
»Ich juble auf. Des Kerkers Schloß
erklirrt;
Ich werde endlich, endlich nun entlassen.
Ade! Und wer sich weiter in mir irrt,
Der mag getrost mich auch noch weiter hassen!«
28 Zum neuen Selbstverständnis des Autors
Abschließend möchte ich auf die schon zitierte Bemerkung Hans
Wollschlägers zurückkommen: Inwiefern liegt die »Wahrheit« von ›Mein Leben
und Streben‹ – jenseits des rein Faktischen – »gänzlich außerhalb der
Dokumente«?[77]
Dass May, wie Thomas Kramer schreibt, »vieles, allzu vieles in seiner Biographie erfunden hat«,[78] ist zwar, bezogen auf ›Mein Leben und Streben‹, eine unbewiesene und, wie ich meine, unzutreffende Behauptung. Doch die Wahrheit in Mays Selbstdarstellung liegt, so würde ich sagen, nicht nur und nicht in erster Linie in der weitgehenden ›Richtigkeit‹ von beschriebenen Sachverhalten. Sie liegt vor allem in Mays neuer Deutung seiner Lebensgeschichte und seines literarischen Schaffens.
Diese neue Sichtweise des Dichters ist nach meinem Dafürhalten nicht als billige Ausrede und nicht als weitere Selbstinszenierung eines Hochstaplers abzutun. Sie ist keine Ausflucht und keine Selbst-Täuschung, sondern eine wirkliche, eine weiterführende Selbst-Erkenntnis des Menschen und des Autors Karl May.
Zwar bleibt so manches noch offen, das »Karl May-Rätsel« (S. 12) kann ich nicht vollständig lösen. Ich kann nicht alle Fragen des menschlichen Lebens und ich kann auch nicht alle Fragen der May-Forschung beantworten. Aber ich glaube sagen zu können: Mays Selbstbiographie ist stimmig in erstaunlich vielen Details und sie ist wahr in einem höheren Sinne.
Wahr in einem die Welt überschreitenden Sinne ist nicht zuletzt Mays Vertrauen auf die göttliche Gnade und Barmherzigkeit. Des Autors finale Bitte, dass Gott in ihm »zum frohen Ende« (S. 320) führen möge, was in »Ardistan«, im Elend des Elternhauses so kläglich begonnen hat, diese Bitte ist nach meiner Überzeugung wirklich echt und authentisch, frei von jeder Heuchelei oder Selbstbemitleidung, frei auch von narzisstischen Untertönen (die auch in der Selbstbiographie mitunter noch anklingen).
In ›Mein Leben und Streben‹, wie auch schon in früheren Erzählwerken, bringt May seine Existenz und sein schriftstellerisches Wirken in ein – so Rüdiger Schaper – »christliches Koordinatensystem«.[79] Während Rüdiger Schaper, dem zur Skepsis neigenden Journalisten (der May als genialen Künstler ja durchaus bewundert), das »christliche Koordinatensystem« nur ein mildes Lächeln und allenfalls ein gewisses Mitgefühl entlockt, ist für mich Karl May eine – gerade auch in Bezug auf das Religiöse – ernst zu nehmende Persönlichkeit und ein, bei allen Fehlern und Schwächen, überaus liebenswürdiger Mensch (was ja von vielen Zeitgenossen bestätigt wird). Und mag Karl May auch oftmals, besonders in den Erfolgsjahren, übertrieben oder kräftig geflunkert haben[80] – ›Mein Leben und Streben‹ ist nicht nur ein gutes und außerordentlich schönes, sondern ebenso ein wahrhaftiges Buch.
Mein Resümee: Die modische Floskel ›sich selbst neu erfinden‹ passt zu Mays Selbstbiographie überhaupt nicht. Im letzten Lebensjahrzehnt lernte es Karl May, seine innere Bestimmung, sein wirkliches und ursprüngliches Lebensziel (die geistigen Höhen von »Dschinnistan«) bewusster wahrzunehmen und besser zu verstehen. So gesehen hat sich der Dichter in ›Mein Leben und Streben‹ nicht etwa neu ›erfunden‹ oder gar neu ›erschaffen‹. Es ist ihm vielmehr gelungen, sein Leben – und vor allem sein Streben – neu und realitätsnah zu interpretieren, in seiner Vita einen tieferen Sinn zu entdecken und somit, mehr und mehr, zu seiner ›Eigentlichkeit‹ zu finden. Dieser Reifungsweg eines hoch interessanten, in seinem ›Leben und Streben‹ exemplarischen Menschen wird in der Selbstbiographie Karl Mays aufs eindrucksvollste erhellt.
Anmerkungen
[1]
Seitenangaben in ( ) beziehen sich auf Karl May: ›Mein Leben und Streben‹.
Freiburg o. J. (1910). Reprint der Originalausgabe. Hg. und mit
Anmerkungen versehen von Hainer Plaul. Hildesheim/New York 1982.
[2] Das Wort (nicht die Idee!) »Dschinnistan« dürfte
Karl May der Märchensammlung Dschinnistan oder auserlesene Feen- und
Geistermärchen (1786/89) von Christoph Martin Wieland entnommen haben.
[3] ›Karl
May, der sächsische Phantast. Studien zu Leben und Werk‹. Hg. von
Harald Eggebrecht. Frankfurt a. M. 1987.
[4] Hermann Kant: ›Die
Aula‹. Berlin 1971 (EA 1965), S. 420.
[5] Martin Nicol: ›Karl
May als Ausleger der Bibel. Beobachtungen zur ›Old
Surehand‹-Trilogie‹. In: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft (Jb-KMG)
1998. Husum 1998, S. 305–320.
[6] Abgesehen von einer kurzen Episode des,
vermutlichen, Unglaubens in der Zeit um 1870; vgl. Karl May: ›Ange et Diable‹. In: Jb-KMG
1971. Hamburg 1971, S. 128–132.
[7] Dieses – im Kontext merkwürdige – »sozusagen«
bedeutet, möglicherweise, eine Einschränkung, die sich auf die oben
Anm. 6 erwähnte Episode beziehen könnte.
[8] Dazu Hermann Wohlgschaft: ›Heute an Gott
glauben. Wege zur Gotteserfahrung.‹ Aschaffenburg 1983; ders.: ›Erfülltes Leben. Was aber
bleibt nach dem Tod?‹ Würzburg 2011; ders.: ›Die
Sehnsucht des Menschen – eine Liebe, die nicht vergeht.‹ Würzburg
2012.
[9] Rüdiger Schaper: ›Karl
May. Untertan, Hochstapler, Übermensch.‹ München 2011.
[10] Ebd.,
S. 167.
[11] Ebd., S. 88.
[12] Hans Wollschläger: (Werkartikel zu) ›Mein Leben und Streben‹. In: ›Karl-May-Handbuch‹. Hg. von
Gert Ueding in Zusammenarbeit mit Klaus Rettner. Würzburg 2001, S.
457; vgl. Helmut Schmiedt: ›Karl Mays ›Mein Leben und Streben‹ als
poetisches Werk‹. In: Jb-KMG 1985. Husum 1985, S. 85–101; ders.: ›Karl
May oder Die Macht der Phantasie‹. München 2011, S. 11–16.
[13] Schmiedt: ›Karl
Mays ›Mein
Leben und Streben‹ als poetisches Werk‹, wie Anm. 12, S. 99.
[14] Vgl. Martin Lowsky: ›Spuren
Johann Peter Hebels in Karl Mays Autobiographie‹. In: Mitteilungen der
Karl-May-Gesellschaft (M-KMG) 56/1983, S. 3–6.
[15] Schmiedt: ›Karl
Mays ›Mein
Leben und Streben‹ als poetisches Werk‹, wie Anm. 12, S. 99.
[16] Nach Plaul, wie Anm. 1, S. 353f. (Anm. 64).
[17] Vgl. Schmiedt: ›Karl
Mays ›Mein Leben und Streben‹ als poetisches Werk‹, wie Anm. 12, S.
85.
[18] Vgl. zum Folgenden Hermann Wohlgschaft: ›Karl May. Leben und Werk.‹
(Karl Mays Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Abt. IX: Materialien.
Bd. I.1-3) Hg. in Zusammenarbeit mit der Karl-May-Gesellschaft.
Bargfeld 2005, S. 26ff.
[19] Schmiedt: ›Die
Macht der Phantasie‹, wie Anm. 12, S. 26.
[20] Ekkehard Bartsch in einem Beitrag vom 4. 2. 2006
im Internet-Diskussionsforum ›Café el Kahira‹.
[21] Ebd.
[22] Vgl. Karl May: ›Briefwechsel
mit Friedrich Ernst Fehsenfeld II‹. Gesammelte Werke Bd. 92. Hg. von
Dieter Sudhoff u. Hans-Dieter Steinmetz. Bamberg/Radebeul 2008, S.
278f.
[23] Vgl. Wohlgschaft: ›Karl
May‹, wie Anm. 18, S. 1943ff.
[24] Hainer Plaul: Nachwort zu ›Mein
Leben und Streben‹, wie Anm. 1, S. 532.
[25] Plaul, wie Anm. 1, S. 325–498 (Anmerkungen).
[26] Vgl. Ralf Harder/Hartmut Bauer: ›Die
Taschenuhr-Affäre – Diebstahl oder Intrige?‹
[27] Vgl. Thomas Pilz-Lorenz: ›Hinter
den Mauern – Schatten und Licht in Osterstein‹. In: Der Beobachter an
der Elbe, Nr. 21/2013, S. 4ff.
[28] Wollschläger, wie Anm. 12, S. 455f.
[29] Dazu schon Otto Forst-Battaglia: ›Traum eines Lebens – Leben
eines Träumers‹. Beiträge zur Karl-May-Forschung Bd. 1. Bamberg 1966,
S. 34ff.
[30] Zit. nach Plaul, wie Anm. 1, S. 325 (Anm. 1).
[31] Nach ebd. wurde Mays Großvater »nach hoher
Consistorial-Verordnung in aller Stille an einem abgesonderten Ort des
Gottesackers« begraben, und zwar früh morgens um 2 Uhr.
[32] Andreas Graf: ›Großer
Wurf mit kleinen Schönheitsfehlern – Sudhoffs und Steinmetz’
Karl-May-Chronik im KMV‹. In: M-KMG 146/2005, S. 47f.
[33] Helmut Schmiedt: ›Karl
May. Studien zu Leben, Werk und Wirkung eines Erfolgsschriftstellers‹.
Königstein/Ts. 1979, S. 28; ähnlich ders.: ›Die
Macht der Phantasie‹, wie Anm. 12, S. 34 (die Frage nach dem
Wirklichkeitsgehalt des Fluchtversuchs lässt Schmiedt hier allerdings
offen).
[34] Claus Roxin: ›Vorläufige
Bemerkungen über die Straftaten Karl Mays‹. In: Jb-KMG 1971. Hamburg
1971, S. 100.
[35] Wilhelm Griesinger: ›Die
Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten für Aerzte und
Studirende‹. Braunschweig 3. Auflage 1871. – Dieses Werk findet sich
in Mays Bibliothek in der Villa »Shatterhand.« in Radebeul.
Unterstreichungen oder sonstige Einträge aus der Feder Mays sind in
diesem Bibliotheks-Exemplar – laut Auskunft von Hans Grunert – nicht
enthalten.
[36] Dazu Plaul: Nachwort, wie Anm. 24, S. 521ff.
[37] Vgl. Harder/Bauer, wie Anm. 26.
[38] Eine leichtere Form von episodischer
schizophrener Erkrankung ist allerdings nicht mit hundertprozentiger
Sicherheit auszuschließen. ›Spontanheilungen‹
ohne Medikation (zu Mays Zeiten gab es keine wirksamen
Psychopharmaka!) und sonstiger psychiatrischer Behandlung sind zwar
höchst selten, aber nicht völlig unmöglich.
[39] Näheres bei Wohlgschaft: ›Karl
May‹, wie Anm. 18, S. 220ff. (zu einem Gutachten des Günzburger
Psychiaters Dr. Edgar Bayer).
[40] Dazu – ausführlich – ebd., S. 213–233, 313f. u.
330–334.
[41] Vgl. Johannes Zeilinger: Autor in fabula. Karl
Mays Psychopathologie und die Bedeutung der Medizin in seinem
Orientzyklus‹. Materialien zum Werk Karl Mays Bd. 2. Hamburg 2000;
ders.: ›Karl
Mays frühkindliche Blindheit – eine Legende?‹ In: Jb-KMG 2000. Husum
2000, S. 179–194.
[42] Thomas Kramer: ›Karl
May. Ein biographisches Porträt‹. Freiburg 2011, S. 34.
[43] Nach ebd., S. 31–35.
[44] In seinem Brief vom 20. 3. 1897 an einen
Insassen einer Blindenanstalt im Elsass hatte May – mit Bezug auf den
Reiseroman ›Old
Surehand I‹ (1894) – geschrieben, dass er selbst »blind gewesen« sei;
zit. nach Dieter Sudhoff/Hans-Dieter Steinmetz: ›Karl-May-Chronik
Bd. II‹, Bamberg/Radebeul 2005, S. 18.
[45] Vgl. unten Anm. 54.
[46] Dazu Ralf Harder: Die Erblindung – eine
entscheidende Phase im Leben Karl Mays II. In: M-KMG 124/2000, S.
20ff.
[47] Vgl. Wilhelm Uhthoff: ›Weitere
Beiträge zum Sehenlernen Blindgeborener und später mit Erfolg
operierter Menschen, sowie zu dem gelegentlich vorkommenden Verlernen
des Sehens bei jüngeren Kindern, nebst psychologischen Bemerkungen bei
totaler kongenitaler Amourose‹. In: Zeitschrift für Psychologie und
Physiologie der Sinnesorgane. Vol. 14. Leipzig 1897, S. 222ff.; Oskar
Eversbusch: ›Die Augen-Erkrankungen im Kindesalter‹. Leipzig 1912, S.
647; Christina Alschner: ›Karl Mays frühkindliches Augenleiden‹. In:
Karl May Haus Information Nr. 19. Hohenstein-Ernstthal 2005, S. 38–44,
bes. S. 42f.
[48] Vgl. William E. Thomas: ›Karl
May und Rachitis‹ (Onlinefassung).
In: M-KMG 125/2000, S. 6–10.
[49] Dazu Ralf Harder: ›Das Kurländer Palais –
Schicksalsstätte für Karl May‹.
[50] Vgl. Wohlgschaft: ›Karl May‹, wie Anm. 18, S.
48–56.
[51] Vgl. Harder: ›Erblindung‹,
wie Anm. 46, S. 24; ders: ›Kurländer
Palais‹, wie Anm. 49. – Schmiedt: ›Die Macht der Phantasie‹, wie Anm.
12, S. 30, schließt sich der Auffassung Johannes Zeilingers (s. oben
Anm. 41) an und lässt sich auf Harders Gegenargumente überhaupt nicht
ein. – Dasselbe gilt für Kramer, wie Anm. 42, S. 31–35; Schaper, wie
Anm. 9, S. 55–58.
[52] Antoine de Saint-Exupéry: ›Der Kleine Prinz‹. Düsseldorf
1973, S. 52.
[53] Kramer, wie Anm. 42, S. 171.
[54] Vgl. z. B. Heinz Stolte: ›Die Reise ins Innere. Dichtung
und Wahrheit in den Reiseerzählungen Karl Mays‹. In:Jb-KMG 1975.
Hamburg 1974, S. 11–33; Walther Ilmer: ›Durch
die sächsische Wüste zum erzgebirgischen Balkan. Karl Mays erster
großer Streifzug durch seine Verfehlungen‹. In: Jb-KMG 1982. Husum
1982, S. 97–130; ders.: ›Das
Märchen als Wahrheit – die Wahrheit als Märchen. Aus Karl Mays ›Reise-Erinnerungen‹ an den
erzgebirgischen Balkan‹. In: Jb-KMG 1984. Husum 1984, S. 92–138.
[55] Franz Langer: ›Die
Schund- und Giftliteratur und Karl May, ihr unerbittlicher Gegner‹
(1909). In: ›Schriften
zu Karl May‹. Ubstadt 1975, S. 203.
[56] Vgl. Wohlgschaft: ›Karl May‹, wie Anm. 18, S.
852–888, bes. S. 858–871.
[57] Vgl. oben Abschnitt 8.
[58] In manchen Reiseerzählungen Karl
Mays, auch in manchen Jugendromanen und vor allem im Kolportageroman ›Waldröschen‹ gibt es einige
Passagen, die hinter dem sonst hohen ethischen Niveau des Mayschen
Schrifttums deutlich zurückbleiben.
[59] Dazu nach wie vor unübertroffen:
Claus Roxin: ›»Dr. Karl May, genannt Old Shatterhand«. Zum Bild Karl
Mays in der Epoche seiner späten Reiseerzählungen‹. In: Jb-KMG 1974.
Hamburg 1973, S. 15–73.
[60] Wohlgschaft: ›Karl
May‹, wie Anm. 18, S. 22.
[61] Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm
Meisters Lehrjahre (8. Buch, Lied der Mignon).
[62] Dazu Mays Vortrag vom 18. 10. 1908
in Lawrence/Massachusetts zum Thema ›Drei Menschheitsfragen: Wer sind
wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir?‹; vgl. Wohlgschaft: ›Karl May‹, wie Anm. 18, S.
1798–1803.
[63] Vgl. Hermann Wohlgschaft: ›»Dort werden wir uns
wiedersehen …« Die »Lebens- und Sterbensphilosophie« Karl Mays im
Kontext der Geistesgeschichte‹. In: Jb-KMG 2011. Husum 2011, S.
131–174.
[64] Johannes 10, 10.
[65] Friedrich Salomo Krauss: ›Karl Mays Selbstbiographie‹.
In: Ders. (Hg.): ›Anthropophyteia‹.
Bd. VIII. Leipzig 1911, S. 501.
[66] May: ›Briefwechsel‹,
wie Anm. 22, S. 264.
[67] Vgl. Wohlgschaft: ›Die »Lebens- und
Sterbensphilosophie« Karl Mays‹, wie Anm. 63, bes. S. 142f. u.
163–166.
[68] Vgl. Hermann Wohlgschaft: ›»Die Schöpfung ist noch nicht
vollendet.« Der Entwicklungsgedanke bei Karl May und Pierre Teilhard
de Chardin.‹ In: Jb-KMG 2003. Husum 2003, S. 141–188; ders.: ›Karl May und die
Evolutionstheorie. Quellen – geistesgeschichtlicher Hintergrund –
zeitgenössisches Umfeld‹. In: Ebd., S. 189–243.
[69] Karl May: Ange et Diable, wie Anm.
6, S. 129.
[70] Vgl. z. B. Karl May: ›Das Buch der Liebe‹ (anonyme
Erstausgabe 1875/76). Karl Mays Gesammelte Werke Bd. 87. Hg. von
Dieter Sudhoff. Bamberg 2006, S. 309–311.
[71] Vgl. Johannes 16, 1.
[72] Aurelius Augustinus: Bekenntnisse
I.1; zit. bei May: ›Das
Buch der Liebe‹, wie Anm. 70, S. 76.
[73] Johannes 14, 6.
[74] Vgl. Wohlgschaft: ›Die »Lebens- und
Sterbensphilosophie« Karl Mays‹, wie Anm. 63, passim.
[75] Wollschläger, wie Anm. 12.
[76] Kramer, wie Anm. 42, S. 29.
[77] Vgl. Hainer Plaul: ›Editorischer Bericht‹ (zu ›Mein Leben und Streben‹). In:
Karl May: ›Mein
Leben und Streben‹. Karl Mays Werke. Historisch-kritische Ausgabe (Hg.
von der Karl-May-Gesellschaft) Bd. VI.1. Bamberg-Radebeul 2012,
S. 390ff.
[78] Ebd., S. 391.
[79] Schaper, wie Anm. 9, S. 69.
[80] Dazu Roxin: »Dr. Karl May, genannt
Old Shatterhand«, wie Anm. 59, passim; Wohlgschaft: ›Karl May‹, wie
Anm. 18, S. 1038–1050.