

Eingang der
Karl-May-Höhle im Oberwald, heutige Ansicht.
Ihre romantische Lage hat Karl May in ›Die Rose von Ernstthal‹ (1874)
trefflich beschrieben. Er lässt einen Handwerksburschen, der in der Höhle
nächtigte, erwachen und aus dem Stolleneingang hinausblicken:
»Es war ein goldener, sonniger Julimorgen. Längst
schon hatte die Feuchtigkeit des nächtlichen Thaues den Weg zum Aether
gefunden; die Wärme des Tages wallte sichtbar um die braunen Stengel der
noch blüthenlosen Erica und erquickender Duft fluthete durch die Zweige
des stillen, geheimnisvollen Waldes.
Die Vögel, ermüdet durch die Morgenabtheilung ihres täglichen
Concertprogrammes, saßen sinnend unter dem grünen Plafond, durch dessen
Öffnung sich das Licht in zauberischen Tönen brach, der Bach murmelte sein
ewiges, einschläferndes Schlummerlied …«
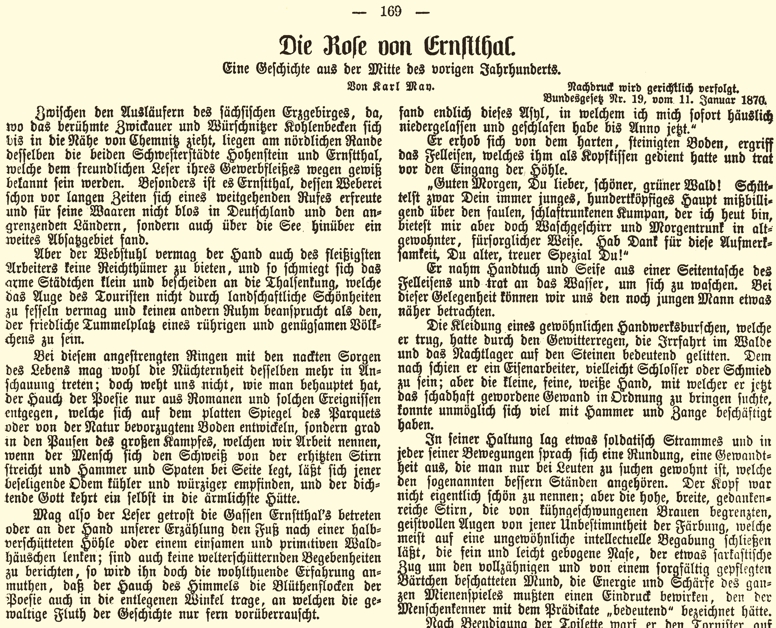
Erstveröffentlichung von ›Die Rose von Ernstthal‹, in: ›Deutsche Novellen-Flora‹, Verlag von Hermann Oeser, Neusalza 1874.
Jene Eisenhöhle und mindestens einen zweiten Stollen soll ein Lungwitzer
Bürger namens Haugk 1620 in den Kiefernberg, der inmitten des Oberwaldes
liegt, getrieben haben. Der Chronist Christian Friedrich Marburg notierte
im nachhinein: Haugk »trieb etwa 20 Lachter Stoln (ca. 40 Meter, d. A.),
da es ihm an Unterstützung fehlte, so verarmte er darüber.« Tatsächlich
legte man Anfang des 17. Jahrhunderts mehrere Stollen am Kiefern-
beziehungsweise am vorgelagerten Steinberg an. Nur die Karl-May-Höhle
blieb bis heute erhalten. Sie führt 33 Meter in den gewachsenen Fels
hinein. Nach 20 Metern gabelt sich der Stollen in einen linken 9 Meter und
einen rechten 13 Meter langen, zunehmend enger werdenden Gang. Die
Karl-May-Höhle war zu DDR-Zeiten über lange Jahre bergamtlich verwahrt und
das Betreten nicht gestattet. Inzwischen ist sie seit einigen Jahrzehnten
für den interessierten Besucher wieder begehbar gemacht. Wanderern sei die
Mitnahme einer Taschenlampe empfohlen. Der von Karl May vermutlich
wirklich als Unterschlupf genutzte Stollen, auch der große Eisenstollen
genannt, soll etwa 60 Meter lang und viel geräumiger gewesen sein. Er lag
am Steinberg unmittelbar im Steinbruchbereich. Zu Zeiten Karl Mays ging
dieser Gegend im Oberwald kein guter Ruf voraus, was aber nichts mit Karl
May zu tun hatte. Die alten Stollen am Kiefern- bzw. Steinberg trugen den
Namen ›Räuberhöhlen‹, eine Bezeichnung, die sich aus Ereignissen der Jahre
1771/72 herleitet, als Mißernten Teuerung und Hungersnot mit sich
brachten. Eine Räuberbande unter dem Hohensteiner Christian Friedrich
Harnisch trieb in der Umgegend ihr Unwesen. Nach Ergreifung der Räuber
fand man das Diebesgut im Wert von etwa 15 000 Talern in eben diesem
Stollen. Das kann auf keinen Fall der heute als Karl-May-Höhle bekannte
Stollen gewesen sein, er ist viel zu nass, zu eng und zu niedrig.
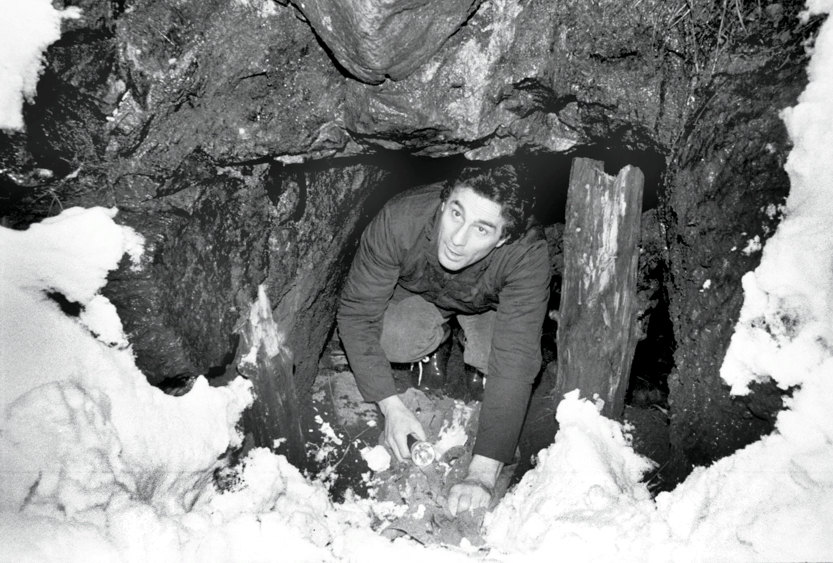
Winnetou war tatsächlich
in der Karl-May-Höhle. Gojko Mitić beim Verlassen der Höhle am 27. Februar
1988.
Der Brunnenbauer Kurt Kunze erhielt vor 1930 den Auftrag diesen großen
Stollen zu sprengen. Hans Zesewitz berichtete 1933, die große Eisenhöhle
sei schon Jahre von Abraum verschüttet gewesen. Der Steinbruch florierte
in den 30er-Jahren, so dass die Befürchtung bestand, die kleine Eisenhöhle
könne auch zerstört werden. Hans Zesewitz setzte sich für deren Erhalt
ein, er mobilisierte dazu Fürst Günther von Schönburg-Waldenburg, den
Verleger E. A. Schmid aus Radebeul, die Stadt Hohenstein-Ernstthal und
schließlich den Steinbruchbesitzer Otto Uhlig aus Zöblitz. Richard Clauß,
der Steinbruchmeister, meiselte in einen Stein über dem Eingang »K. May
Höhle«. Die oben genannten fanden sich am 18. Mai 1933 vor Ort ein und
benannten die Höhle offiziell nach dem Schriftsteller.

Einmeiselung über dem Eingang zur Karl-May-Höhle aus den 1980er-Jahren, so findet man sie heute vor.
Sicher ist die Karl-May-Höhle wohl die meistbesuchte Stätte im Oberwald,
selten ist man dort ganz allein, wenn man eine Zeit verweilt. Von Zeit zu
Zeit machte die Karl-May-Höhle von sich reden. 1976 drehte das
DDR-Fernsehen am Pechgraben für den siebenteiligen Krimi ›Gefährliche
Fahndung‹, in einer kurzen Szene tauchte der teils noch verwahrte Eingang
mit der erwähnten Schrift ›K. May Höhle‹ auf. Ein Teil dieses Steines
befindet sich heute im Karl-May-Haus. Die heutige Inschrift wurde in den
80er-Jahren eingemeiselt. 1984 drehte das Fernsehen eine viertelstündige
›Ansichtskarte‹ mit dem im Umbau befindlichen Karl-May-Haus und mit der
Innenansicht der Höhle. In diesem Jahr kommt die Karl-May-Höhle wieder ins
Gespräch, da sich Karl May vor 150 Jahren bei Kuhschnappel aus dem
Gewahrsam eines Beamten befreite, in Richtung Wald floh und sich in der
Höhle verschanzte. Die ganze Geschichte findet sich im Gemeindespiegel St.
Egidien in einem ausführlichen Artikel von Andreas Barth. Sicher steht das
Karl-May-Haus für May-Verehrer aus aller Welt bei einem Aufenthalt in
Hohenstein-Ernstthal im Zentrum und die ganze Stadt wurde bisher als ein
Freilichtmuseum im Zeichen Karl Mays mit vielen Maystätten, wozu auch die
Karl-May-Höhle gehört, wahrgenommen, aber das Flair geht mehr und mehr
verloren. Eine historische Ansicht nach der anderen, ebenso
Karl-May-Stätten verschwinden aus dem Stadtbild. Wie anderen Orts solche
Stätten für touristische Zwecke genutzt werden, zeigte Dr. Christian
Heermann (1936–2017), der langjährige Vorsitzende des Wissenschaftlichen
Beirats des Karl-May-Hauses, am Beispiel von Hannibal, der Heimatstadt von
Mark Twain, auf. Die Besuchermagneten Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind
die unverzichtbaren Botschafter der Stadt am Mississippi. Könnten nicht in
ähnlicher Weise Mays literarische Schöpfungen, manche gar mit Heimatbezug
wie die ›Rose von Ernstthal‹, das Stadtbild in Hohenstein-Ernstthal für
einen ganzjährigen Karl-May-Tourismus beleben?

Dr. Christian Heermann,
Dr. Hainer Plaul und Andreas Barth am Pechgraben vor der Karl-May-Höhle.
Dieser Besuch erfolgte am 13. September 2016 anlässlich des 80.
Geburtstages von Dr. Heermann.