
Mitternachtsverpflegung, Christa Mätzold und Ekkehard Fröde. – Archiv Wolfgang Hallmann.
Der Gedanke, im Geburtshaus Karl Mays einer Ausstellung zu Ehren des
großen Sohnes der Stadt Hohenstein-Ernstthal zu etablieren, bewegte seine
Verehrer schon vor Jahrzehnten. Abgesehen vom Anbringen der Gedenktafel an
der Fassade des Hauses im Jahre 1929 gab es wohl 1942 den ersten Versuch,
eine Ausstellung zu Mays Leben und Werk in der Karl-May-Straße 54 zu
zeigen. Sicher hat sich auch 1967 der Freundeskreis Karl May in
Hohenstein-Ernstthal mit Stefan Köhler, Lothar Layritz, Adolf Stärz,
Friedrich Bachmann, Alfred Münch, Werner Polmar und Hans Zesewitz mit
ähnlichen Gedanken getragen. Allein die damaligen gesellschaftlichen
Verhältnisse verhinderten die Tätigkeit dieses Kreises. 1977 führte ich
mit dem damaligen Bürgermeister Horst Bigus in diesem Sinne ein längeres
Gespräch zur Nutzung des Karl-May-Hauses. May ein Denkmal zu setzen,
gehörte nicht zu seinem inneren Anliegen, auch fehlte ihm ein
obrigkeitlicher Impuls und die Gewissheit, dass er sich nicht auf
eventuell vermintem Gelände bewegte. Die Zeit war einfach noch nicht reif.
1979 legte der 5. Philosophie-Kongress der DDR die theoretischen
Grundlagen für eine neue Herangehensweise an Persönlichkeiten der
Vergangenheit. Karl May wurde in der offiziellen DDR wieder schrittweise
salonfähig, bei seinen Lesern war er es immer geblieben, auch im Osten.
Die Weihnachten 1982 ausgestrahlte Fernsehdokumentation ›Ich habe Winnetou
begraben‹, die Dr. Hainer Plaul (Berlin) und Gerhard Klussmeier (Hamburg)
maßgeblich unterstützten, bot den Auftakt für eine Karl-May-Renaissance in
der DDR. Extra für die dazu nötigen Dreharbeiten in Hohenstein-Ernstthal
wurde der letzte Bewohner des Hauses Karl-May-Straße 54, Horst Dosda, auf
Dauer ausquartiert, die heruntergekommene Fassade des Hauses erhielt eine
neue Außenhaut in abgestuftem Grau, die in der Bevölkerung die
kurzfristige Bezeichnung DEFA-Kulissenanstrich führte. Schließlich
erreichte Hohenstein-Ernstthal, in der Provinz Ardistan gelegen, der etwas
oberflächliche Ruf der Obrigkeit, im Karl-May-Haus eine Gedenkstätte für
Karl May einzurichten. Mit allerlei Unsicherheit ließ man die Abteilung
Kultur beim Rat des Kreises Hohenstein-Ernstthal eine Vorlage für die
Ratssitzung am 17. März 1983, die die Nummer 41/83 trug, erstellen. Diese
wurde mit dem Rat der Stadt Hohenstein-Ernstthal, dem Direktor der
Gebäudewirtschaft und dem Kreisbaudirektor abgestimmt beziehungsweise
durchgedrückt. Am gleichen Tag fasste der Rat des Kreises den Beschluss
für den Ausbau des Karl-May-Hauses zu einer ›Gedenkstätte‹. Die
einführende Begründung dafür lautete:
»Der gegenwärtig erreichte hohe Reifegrad des politischen
Bewusstseins und die gefestigte vom Marxismus-Leninismus bestimmte
weltanschauliche Basis sind eine wichtige Grundlage für die
schöpferisch-kritische Aneignung des gesamten Kulturerbes.
Mit dem Ausbau des Karl-May-Hauses zu einer Gedenkstätte soll
das kulturelle Erbe, was uns der Schriftsteller Karl May hinterlassen hat,
für eine weitere Vertiefung des sozialistischen Heimatbewusstseins
intensiv genutzt werden. In enger Gemeinschaftsarbeit zwischen der
SED-Kreisleitung, des Rates des Kreises Hohenstein-Ernstthal, des Rates
der Stadt Hohenstein-Ernstthal, den Massenorganisationen und Betrieben des
Territoriums wollen wir die Initiativen und Aktivitäten der Bürger auf die
originale Erhaltung des in der Kreisdenkmalliste vom 27. November 1980
enthaltenen denkmalgeschützten Objektes lenken.
An der Lösung der vielfältigen Aufgaben zum Ausbau der
Gedenkstätte und der Erforschung der Heimatgeschichte wirken die vom
Kulturbund gegründeten Gesellschaften für Denkmalpflege und
Heimatgeschichte aktiv mit.«

Mitternachtsverpflegung, Christa Mätzold und Ekkehard Fröde. – Archiv
Wolfgang Hallmann.
Unter dem Punkt »Nachweis des Bedarfs« wird in der Vorlage die grobe
inhaltliche Zielstellung vorgegeben:
»Zur Pflege des Nationalen Kulturerbes ist es erforderlich, das
Geburtshaus des 1842 in Ernstthal geborenen Schriftstellers Karl May in
einen Zustand zu versetzen, der der Rolle Karl Mays und den Belangen der
Denkmalpflege […] entspricht.

Ekkehard Fröde und Wolfgang Hallmann beim Ausstellungsaufbau. – Archiv
Wolfgang Hallmann.
Es ist vorgesehen, in den Räumen des Erdgeschosses und 1. Obergeschosses
eine Ausstellung unterzubringen, in der das Leben und Wirken Karl Mays
dargestellt werden soll. Da beides nur im Zusammenhang mit den in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Ernstthal herrschenden politischen
und sozialen Verhältnissen richtig begriffen werden kann, soll diese
Darstellung mit einer Aussage über die Arbeits- und Lebensbedingungen der
Ernstthaler Weber verbunden werden.
Im 2. Obergeschoss sollen die Kreisvorstände der Gesellschaft für
Heimatgeschichte und der Gesellschaft für Denkmalpflege des Kulturbundes
der DDR eine Heimstatt finden.«
Aus diesen Formulierungen spricht eine Besorgnis, sich ja keinen politisch
unkorrekten Zungenschlag zu leisten und sich mit den Floskeln der
Parteiführung abzusichern, aber auch der Vorlage zum Erfolg zu verhelfen.
Die baulichen Belange galten wohl als das geringste Problem, Geld wurde im
Haushalt gesucht und gefunden, insgesamt sollten es 50 000 M sein,
verschiedene Betriebe der Stadt reichten im Rahmen kommunalpolitischer
Verträge Geld dazu aus, so zum Beispiel der IFA-Ingenieurbetrieb 20 000 M.
Heinz Heiland agierte als vom Rat des Kreises eingesetzter Bauleiter.

Schwerpunktmäßig 1983/84 wurde das Haus zunächst weitestgehend entkernt,
nur die Außenwände blieben stehen, und im Dachgeschoss wurde die
historische Raumaufteilung weitestgehend erhalten und nur leicht
verändert. So wurde der Aufgang zum ehemaligen Taubenschlag beseitigt und
die alten Wände wurden mit Holz verkleidet. Eine neu gebaute hölzerne
Wendeltreppe verband die Etagen. Der abgeschlagene Putz in den unteren
Etagen und im Flur erlaubten einen Blick auf das Gemäuer, das sich im
Erdgeschoss gegenüber den höheren Etagen erheblich unterschied und so die
frühere Entstehung als eingeschossiges Haus, das man später aufstockte,
unterstrich.

Innenausbau des Karl-May-Geburtshauses. – Archiv Wolfgang Hallmann.
Die Realisierung des obigen Beschlusses war von Anfang an mit einer
gehörigen Portion Unsicherheit beladen. Das begann mit der Vernichtung der
genannten Vorlage kurz nach ihrer Ausgabe im Rat des Kreises. Der Begriff
Gedenkstätte stieß vielerseits auf Ablehnung. Die SED-Kreisleitung ging
davon aus, dass es für das Haus keine Öffnungszeiten geben sollte, sondern
nur eine gelegentliche Öffnung unter Regie dieser Institution.
Dr. Hainer Plaul, damals Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR
und deutschlandweit als wirklicher Karl-May-Experte bekannt, erhielt den
Auftrag, eine Ausstellungskonzeption für das Museum zu erstellen, was dann
auf wissenschaftlicher Grundlage im Umfang von 90 Seiten in
ausgezeichneter Weise geschah. Doch die Umsetzung und der inhaltliche
Ausbau des Hauses war relativ unklar.

Die Baustelle im Karl-May-Haus: Historisch-gekalktes Fachwerk wird mit
Holz verblendet.
Der einstige Aufgang zum Taubenschlag wird entfernt. – Archiv Wolfgang
Hallmann.
Einzelne Kulturbundmitglieder und Heimatfreunde wie Adolf Stärz, Ekkehard
Fröde, Wolfgang Hallmann, Horst Richter und der Buchhändler Johannes
Zimmermann fanden sich am 14. September 1983 im damaligen Haus der
Massenorganisationen, dem späteren ›La Belle‹ an der Ecke der heutigen
Conrad-Clauß-Straße/Immanuel-Kant-Straße, zur Gründung der
Interessengemeinschaft Karl-May-Haus unter dem Dach des Kulturbundes
zusammen, um die Ausgestaltung des Karl-May-Hauses allseitig zu sichern.
Für eine Vereinsgründung im heutigen Sinne gab es keine Möglichkeit.
Die Ausstellungskonzeption von Dr. Plaul ließ bei der praktischen
Umsetzung relativ weiten Spielraum. Einerseits lagen die Texte für den
Teil Leben und Werk damit vor, aber für die Tafeln und Vitrinen mussten
sie unbedingt gekürzt werden, um die Besucher nicht zu überfordern. Diese
Arbeit nahm der Autor in enger Abstimmung mit Dr. Plaul vor. Schließlich
ergab sich ein Textumfang mit immer noch ca. 2 1/2 Lesestunden. Was aber
die Exponate anbelangte, war außer einer Reihe von Büchern kaum etwas
vorhanden. Wieder war es Dr. Plaul, der teils auf abenteuerliche Weise
fremdsprachige May-Ausgaben aus aller Welt beschaffte, was sich zu
DDR-Zeiten nicht gerade einfach realisieren ließ.
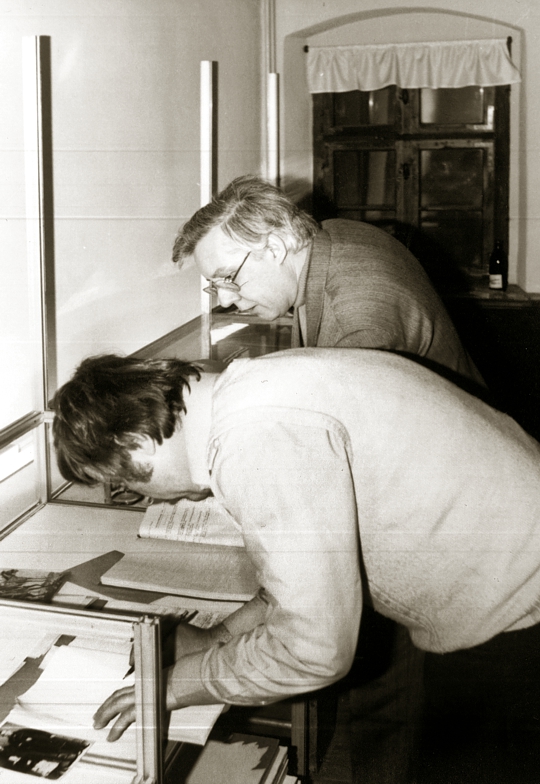
Dr. Hainer Plaul und Wolfgang Hallmann am 14. Februar 1985 bei der Auswahl
der Vitrinentexte.
Archiv Wolfgang Hallmann.
Nach einigen Presseveröffentlichungen setzte eine Welle der
Hilfsbereitschaft ein. Bücher, darunter seltene Exemplare, Dokumente und
Gegenstände, erreichten das Karl-May-Haus als Spenden und Leihgaben. Der
Karl-May-Verlag Bamberg half schließlich ebenso mit, stellte Faksimiles
von alten Urkunden zur Verfügung und später eine Halbleder-Reprintausgabe
der Gesammelten Reiseerzählungen von Fehsenfeld mit 33 Bänden, die Roland
Schmid übergab.
Was die materielle Ausstattung wie Möbel, Museumsgut, den Webstuhl,
Vitrinen, Lampen und anderes mehr anbelangte, entfaltete Ekkehard Fröde
sein volles Organisationstalent. Er organisierte ebenso die Helfer für
alle möglichen speziellen Aufgaben. Max Thomasius baute den Handwebstuhl
auf, Helga Heber und Katrin Lämmel von der Möbelstoffweberei übernahmen
dann das Einrichten und Anweben. Auch im Außenbereich gab es viele
Aufgaben, der Metallrestaurator des Glauchauer Museums reinigte die 1929
angebrachte Gedenktafel an der Fassade des Hauses, und der Chef der GPG
Baumschulen, Rudolf Petrik, pflanzte höchstpersönlich einen Apfel- und
einen Pflaumenbaum sowie den Holunderbusch, schließlich legte er einen
kleinen Wassertümpel für die Frösche an.
Wie für viele Details der Ausstellung wurde Mays ›Mein Leben und Streben‹
(1910) herangezogen, auch wenn heute vermutet wird, dass sich mancher
seiner Hinweise wohl mehr auf den späteren Wohnsitz der Familie May am
Ernstthaler Markt bezogen hat.
Für die Weberstube musste seine Schilderung ebenfalls genügen bis hin zum
›birkenen Hans‹, der Züchtigungsrute, von der Vater Heinrich August May
wohl des Öfteren Gebrauch machte. Die Ausgestaltung dieses Raumes oblag
weitestgehend Adolf Stärz, der auch die verschiedenen lebensgroßen Figuren
schuf, so auch den Kara Ben Nemsi, damals liebevoll nach seinem Schöpfer
Kara Ben Stärzi genannt. Ihm oblag auch die Herstellung von Waffen aus
bestem Fichtenholz, die wie ein Aberwitz von einem Waffenexperten der
Volkspolizei auf Schussunfähigkeit geprüft wurden.

Adolf Stärz bei Arbeiten am Kara Ben Stärzi 1985. – Archiv Wolfgang
Hallmann.
Der spätere Raum für fremdsprachige Buchausgaben nebenan blieb zunächst
das Arbeitszimmer des Karl-May-Haus-Leiters, Ekkehard Fröde. Auf dem
Boden, wo sich zu Mays Zeiten die Schlafkammern der Kinder befanden,
entstanden ein kleiner Archivraum und ein Raum mit Dachschräge für
Sonderausstellungen bzw. als Leseraum.
Viele helfende Hände fanden sich, um das Karl-May-Haus bis zum geplanten
Eröffnungstermin einzurichten. Horst Richter wirkte beim Vitrinenaufbau
und bei Transporten mit. Hans-Joachim Matthes leistete unersetzliche Hilfe
bei der praktischen Gestaltung der Ausstellungstafeln und vieles andere
mehr. Irmgard Hetze und Christa Meyer unterstützten beim Aufziehen von
Textpassagen und Fotos auf Trägermaterialien. Doch die Hauptarbeit zur
Ausgestaltung des künftigen Museums lag in den Händen von Adolf Stärz, von
Ekkehard Fröde, der die Gesamtregie führte, und von Wolfgang Hallmann, der
unter anderem für den Inhalt der Vitrinen und Wandtafeln sorgte.
All die Arbeiten vor Ort waren erst ab Januar 1985 möglich, nachdem die
Handwerker wie Tischler, Klempner, Heizungsbauer, Elektriker, Gürtler und
Maler ihr Werk vollendet hatten. Die Ausgestalter von der IG Karl-May-Haus
wirkten ehrenamtlich in unzähligen Freizeitstunden, oft bis in die tiefe
Nacht hinein, vor allem je näher der Eröffnungstermin heranrückte.
Am Vorabend der Eröffnung, so gegen 23 Uhr, stellten wir fest, dass dem
Ofen in der Weberstube das Ofenrohr fehlte. Adolf Stärz wusste Abhilfe und
fertigte in der Nacht ein ›Ofenrohr‹ aus Wellpappe und strich es mit
Ofenschwärze. Erst jetzt mit der neuen Ausgestaltung des Karl-May-Hauses
hat es nach 30 Jahren ausgedient. Provisorien halten eben am längsten. Die
letzten Maybände wanderten morgens halb vier vor der Eröffnung in die
Vitrinen. Ohne das fast grenzenlose Engagement der kleinen Kerntruppe und
ihrer Helfer wäre die Ausstellung so nie zustande gekommen und dabei kamen
wir uns nicht selten als illegal vor, misstrauisch beäugt von allerlei
Seiten, vor allem von der SED-Kreisleitung. Diese unterstützte die
Arbeiten nicht wirklich, wie in der Vorlage vorgesehen, aber schaute uns
ängstlich über die Schulter, auch von städtischer Seite befürchtete man,
mit unseren Arbeitsergebnissen eventuell politisch anzuecken, zu
überraschend war die Karl-May-Renaissance über sie hereingebrochen. Das
gipfelte sogar darin, dass wir an der inoffiziellen Eröffnung, die für den
12. März 1985 mit der SED-Kreisleitung, der SED-Bezirksleitung, dem Rat
des Bezirkes und dem Rat der Stadt geplant war, nicht teilnehmen sollten.
Es bedurfte erst unserer massiven Intervention beim Bürgermeister, dass
dies möglich wurde.
Ansonsten ließ sich niemand von der regionalen Obrigkeit blicken bis auf
die Abteilungsleiterin Kultur vom Rat des Kreises, Christa Mätzold. Nicht
nur einmal brachte sie uns um Mitternacht einen Imbiss und Getränke und
schoss uns mitunter den Weg frei, wenn die Säge irgendwo klemmte. Einmal
brachten wir sie in Bedrängnis, und zwar mit der illegal produzierten
Broschüre Karl-May-Stätten in Hohenstein-Ernstthal. Das Karl-Marx-Werk
Pößneck hatte sie etwas außerhalb der damaligen gesetzlichen Vorschriften
gedruckt, und 2500 Exemplare lagen seit Anfang 1985 schon in
Hohenstein-Ernstthal. Schließlich wurden die Broschüren vom Rat des
Kreises requiriert, aber zur Eröffnung wieder herausgegeben. Einige mehr
gedruckte Exemplare hatten wir schon verschickt, um Referenzen zu unserer
Sicherheit zu erhalten und sie kamen. Selbst Hermann Kant, der damalige
Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR und Frühbekenner zu May (in
Die Aula, 1965), lobte die Broschüre als bisher bestes Sekundärmaterial
über May. Dies und einiges mehr hatte uns wohl vor größerem Ärger bewahrt.
Es gab da aber noch einen ›stillen Schirmherren‹, den wir als Unterstützer
für das Projekt Karl-May-Haus gewonnen hatten. Schon 1984 führte ich mit
dem Zirkushistoriker Markschiess van Trix aus Berlin ein Gespräch zum
Vorhaben Geburtshaus Karl Mays. Der bot Hilfe an. Unter anderem
vermittelte er eine Einladung zur Eröffnung des Karl-May-Hauses an seinen
Gartennachbarn. Der war kein geringerer als Klaus Höpcke,
stellvertretender Minister für Kultur der DDR von 1973–1989, der sich des
Öfteren für kulturelle Aktivitäten eingesetzt hatte, die nicht unbedingt
als linientreu galten. Sein Kommen signalisierte er nicht, ließ es aber
wohlwollend offen. So konnten wir hier in Ardistan verkünden, dass der
stellvertretende Kulturminister höchstwahrscheinlich zur Eröffnung des
Karl-May-Hauses kommt, das war für das Vorhaben behilflich.
Schließlich kam der große Tag der Eröffnung des Karl-May-Hauses, zunächst
im kleinen Kreis am 12. März 1985, was eher einer Abnahme glich, der die
SED-Kreisleitung mit einigem Bangen entgegensah. Schließlich kam
Politprominenz vom Bezirk, so auch der Sekretär für Agitation und
Propaganda der SED-Bezirksleitung, Wolfgang Enders. Bürgermeister Horst
Bigus hielt die Eröffnungsrede und Ekkehard Fröde führte die Delegation
durch die Ausstellung im ersten Stock. Alle hielten sich mit einer Wertung
oder anerkennenden Worten zurück, bis Wolfgang Enders endlich den
erlösenden Satz aussprach: »Das habt ihr gut gemacht.« Erhard Thurm, der
erste Kreissekretär der SED, wandte sich um und wiederholte
unterstreichend diese Worte. Die Spannung war gelöst, das Museum poltisch
abgesegnet und nun konnte es auch Öffnungszeiten für das Karl-May-Haus
geben.
Am nächsten Tag, dem 13. März 1985, ging die offizielle Eröffnung über die
Bühne. Heerscharen von Karl-May-Freunden drängten sich durch die engen
Räume und Flure. Der Zuspruch der Besucher hielt über lange Zeit
ungebrochen an. Am Sonntag, dem 24. März 1985, kamen in sechs Stunden 710
Besucher. Bis Ende 1988 betraten rund 76 000 Gäste das neue Mekka der
Karl-May-Fans.

Der Kassenraum, wie er in den Anfangsjahren aussah.
Das Foto aus dem Jahr 1992 zeigt Ekkehard Fröde und Kerstin Horváth (heute
Harder) mit Museumsbesuchern.
Inzwischen sind über Jahrzehnte ins Land gegangen. Die Gesellschaft hat
sich gewandelt, Ansprüche an museale Einrichtungen sind enorm gestiegen,
Erkenntnisse über May sind gewachsen, technische und finanzielle
Möglichkeiten sind vergleichsweise unendlich größer geworden. Die Zeit war
mehr als reif für eine Erweiterung des Museums. Nach einer längeren
Bauphase wurde am 2. Juli 2022 das Karl-May-Haus mit einem neuen
Funktionsgebäude für die Besucher wiedereröffnet.
