
Unweit hinter diesem Bretterzaun an der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal wurden Karl Mays Eltern bestattet.
»Vater und Mutter hat man nur einmal. Sind sie gestorben, so hat der Mezarlyk [Kirchhof] den besten Theil des Kindes empfangen, und keine Seele auf Erden meint es mit ihm wieder so gut und treu, wie die Hingeschiedenen.«[1]
In Hohenstein-Ernstthal existiert eine wichtige Karl-May-Stätte, die
bislang unbeachtet geblieben ist, da sie bereits jahrzehntelang als
Kleingartenanlage genutzt wird. Dass sich dort einst die Erweiterung des
alten Ernstthaler Friedhofs befand, seinerzeit als Gottesacker bezeichnet,
dürfte zumindest der jüngeren Generation weitgehend unbekannt sein, obwohl
täglich unzählige Autos am nördlichen Teil des Areals an der Dresdner
Straße vorbeifahren, wo ein jüngst erneuerter Bretterzaun steht. Dahinter
ruhen bis zur Hohen Straße nach wie vor zahlreiche Einwohner der
Karl-May-Geburtsstadt.

Der ursprüngliche alte Ernstthaler Friedhof entstand in den 1680er Jahren.
Nachweislich fanden dort bereits 1687 Begräbnisse statt.[2] Das Gelände erstreckte sich von der
Einmündung Dresdner Straße/Hohe Straße bis zur Bergstraße. Dieser
Abschnitt wurde Anfang der 1990er Jahre mit Mietshäusern bebaut; mit dem
Erdaushub für die Baumaßnahmen verschwanden die historischen Gräber, die
als solche kaum noch erkennbar waren. Es ist nicht auszuschließen, dass
sich in Randbereichen des vormaligen Friedhofs noch Überreste von
Verstorbenen befinden.

Der nicht
mehr erhaltene westliche Teil des historischen Ernstthaler Friedhofs mit
Blick zum Pfaffenberg.
Aufnahme Wolfgang Hallmann, März 1986, damals aufgelassene Gärtnerei
Aurich, heute Wohnstandort, im Volksmund ›Schiffshebewerk‹ genannt.
In der heutigen östlich gelegenen Kleingartenanlage erfolgten – soweit
bekannt – keine nennenswerten Tiefbauarbeiten, sodass die Toten weiterhin
dort ruhen, wenn auch die Grabreihen verschwunden sind. Allerdings ist der
Mittelweg des erweiterten Gottesackers dort noch vorhanden, der 1881
eingeweiht wurde. Die damals notwendige Friedhofserweiterung hatte man
sorgfältig geplant. Es sind noch Entwurfszeichnungen im Archiv der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand vorhanden:
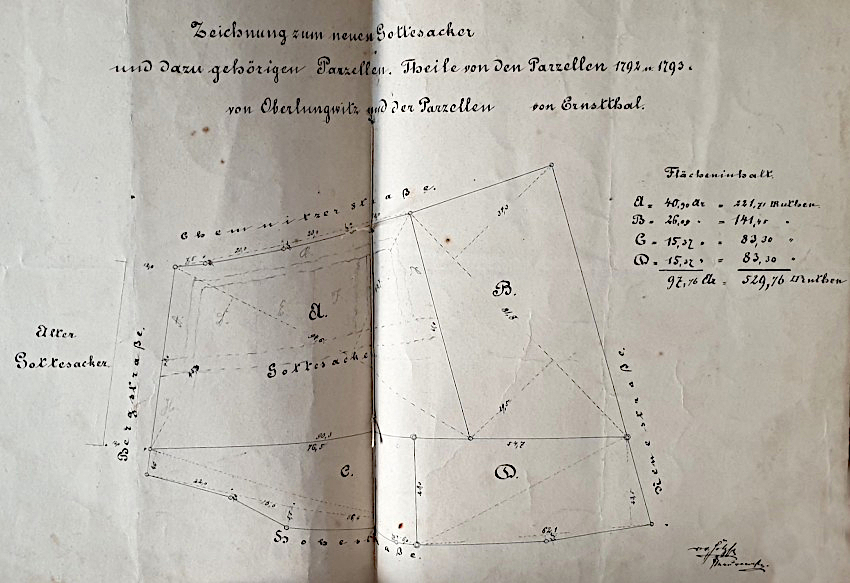
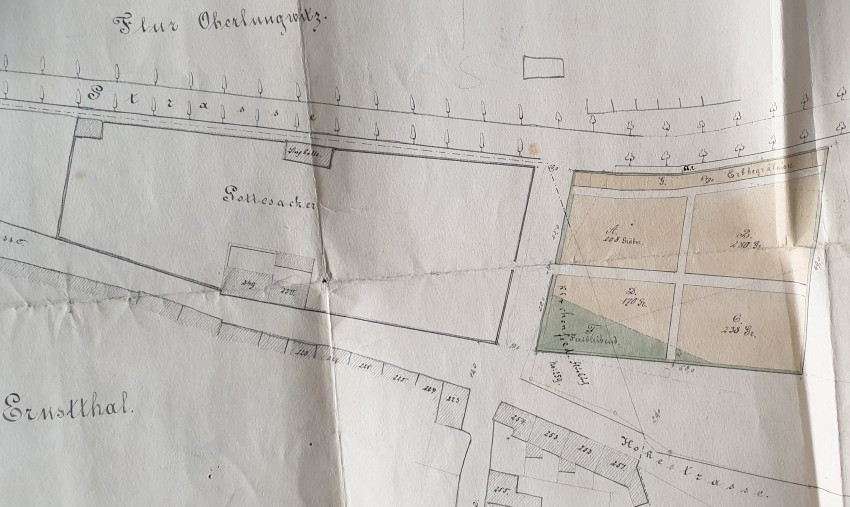
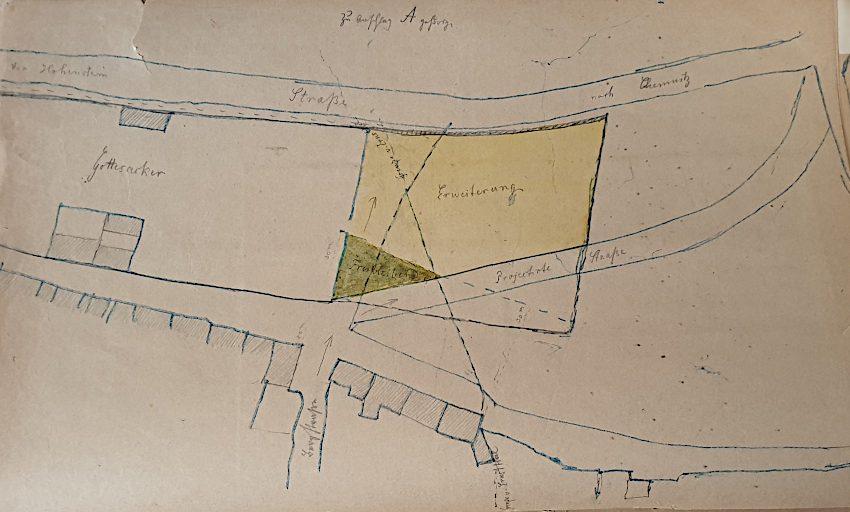
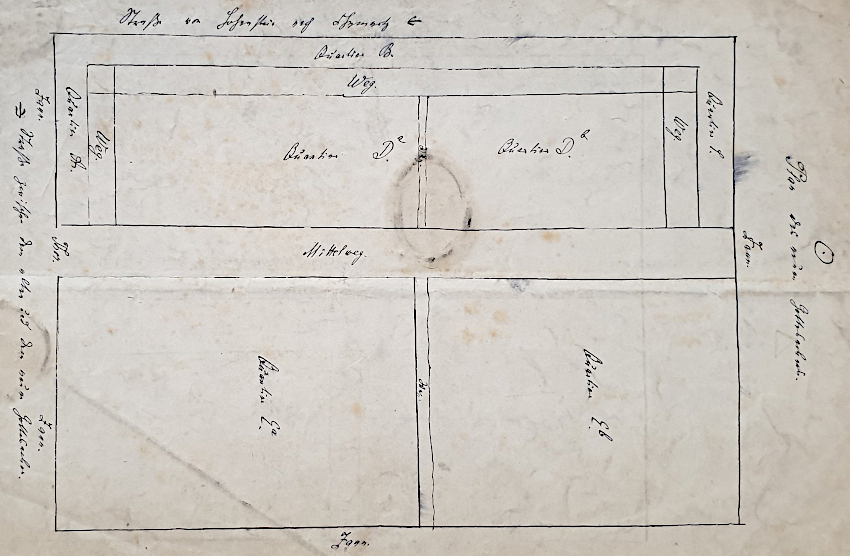
Es war Karl Mays Neffe Max Otto Selbmann, der als erstes
Familienmitglied am 16. Mai 1882 auf dem neuen Friedhofsareal beerdigt
wurde. Das nicht einmal fünfjährige Kind, geboren am 15. Juli 1877,
einziger Sohn seiner Schwester Karoline Wilhelmine, starb an
Scharlachfieber.
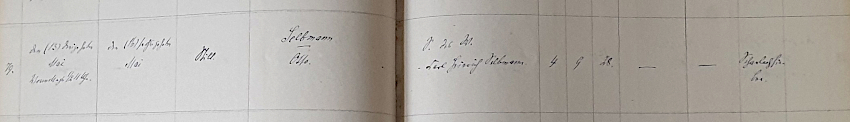
May ist derart betroffen, dass er seine Reiseerzählung ›Die
Todes-Karavane‹ (im Band ›Von Bagdad nach Stambul‹ enthalten) unterbrechen
muss. Anfang Juni 1882 erscheint zunächst die letzte Fortsetzung in der
Regensburger Zeitschrift ›Deutscher Hausschatz‹. Als weiteres Manuskript
entsteht, schreibt er vielsagend:
»Dein Angesicht ist wie Scharlach. Zeige mir deine Zunge!«[4]
Ab 1884 verfasste Karl May seinen Kolportageroman ›Der verlorne Sohn oder
Der Fürst des Elends‹. Dort verarbeitete er literarisch sehr konkret den
Tod seines Neffen :
»›[…] Der Botenfrau ihr Kleiner ist am Scharlach gestorben; den bringen
sie jetzt.‹
›Wird es lange dauern?‹
›O nein. Mit armer Leute Kind wird wenig Federlesen
gemacht; das wißt Ihr ja.‹
[…]
Ein Mann brachte einen kleinen Sarg getragen. Hinter ihm kam die
Leichenfrau und die Mutter des Kindes. Das war der ganze Begräbnißzug.
Diese drei wurden vom Todtengräber empfangen und nach dem Grabe geführt.
Man ließ den Sarg hinab und betete ein stilles Vaterunser. Damit war die
Ceremonie zu Ende. Wenn ein Reicher, ein Vornehmer sich von seinem Kinde
trennt, geschieht es mit größerem Pompe, und doch ist das Herz einer armen
Mutter ebenso empfänglich für das Herzeleid wie dasjenige einer feinen
Dame.
[…]
Auf dem kleinen Sarge lagen einige Feldblumen, welche die arme Mutter
unterwegs gepflückt und dem Kinde in das Grab nachgeworfen hatte.«[5]
Auch die Lage des Friedhofs wird im Zusammenhang mit dem toten Kind im
›verlornen Sohn‹ beschrieben:
»Der Gottesacker lag nämlich oben auf der Höhe und stieß an den dichten
Wald. Ein Weg führte hinab in das Dorf.«[6]
Zu Mays Zeit war die Dresdner Straße, damals Chemnitzer Straße, deutlich
weniger ausgebaut. Dort, wo dicht hinter dem Bretterzaun Max Otto
Selbmann im Quartier B, Reihe 2, Grab 5, bestattet ist, befindet sich
heutzutage auf der anderen Straßenseite am Pfaffenberg ein Wohnhaus.
Früher war dieser Bereich bewaldet. Und mit dem Weg, der in das Dorf
führte, ist der Leichenweg gemeint, die heutige Bergstraße am Ernstthaler
Neumarkt.
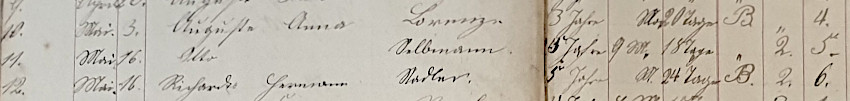
Als Karl May noch den ›verlornen Sohn‹ und zeitgleich parallel ›Die Liebe
des Ulanen‹ zu Papier brachte, ereilte ihn ein weiterer Schicksalsschlag,
der ihn völlig aus der Bahn warf. Dies kündigte sich schemenhaft in der
Nr. 86 seines ›Ulanen‹-Romans an. Über ihr plötzliches Verschwinden legt
er der Zofe von Marion de Sainte-Marie folgende Ausrede in den Mund:
»Ich erhielt kurz nach meinem Erwachen die Nachricht, daß meine
Mutter unwohl sei.«[7]
Und Marion berichtet später:
»Sie gab vor, bis nach fünf Uhr geschlafen zu haben. Dann hat sie die
Nachricht erhalten, daß ihre Mutter, welche im nahen Dorfe wohnt, erkrankt
sei. Dorthin sei sie gegangen.«[8]
May schrieb diese Romanzeilen in seiner Dresdner Wohnung ca. Anfang April
1885. Tatsächlich war seine Mutter erkrankt. Der 5. April war
Ostersonntag. Möglicherweise nutzte er die Feiertage mit seiner Ehefrau
Emma zu einem Krankenbesuch. Am darauffolgenden Samstag waren sie mit
Sicherheit bei der Mutter am Ernstthaler Markt, denn sie beging dort ihren
achtundsechzigsten Geburtstag, und von diesem Zeitpunkt an dürfte Karl May
ständig bei seiner Mutter gewacht haben. Nur vier Tage später wird
Christiane Wilhelmine May von ihrer Krankheit, eine »Geschwulst«, offenbar
Krebs, erlöst.
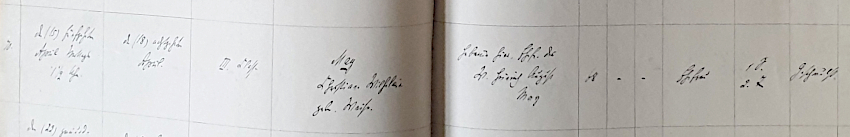
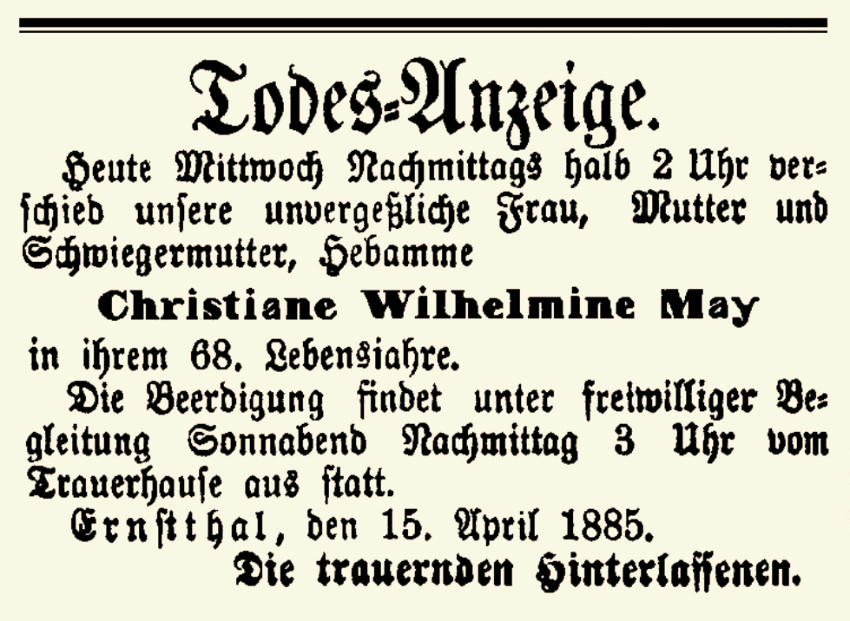
»Als seine Mutter in seinen Armen starb, hielt er sie vom Abend bis zum
Morgen als Leiche in seinen Armen. Handelt so ein uns normal erscheinender
Mensch? Das Grab der Mutter wurde doppelt tief gemacht. Er wollte bei ihr
begraben werden.«[9]
Mays zweite Ehefrau Klara
schrieb diese wichtige Aufzeichnung »in einem flüchtig skizzierten
Aufsatz« nieder.[10]
An den Wahrheitsgehalt ihrer Worte, die ersichtlich auf Mitteilungen ihres
Gatten beruhen, ist nicht zu zweifeln. Der Tod seiner Mutter traf May wie
ein fürchterlicher Schlag auf den Kopf.
»Ich war gestorben; ich besaß keinen Körper mehr; ich war nur Seele, nur
Geist. Ich flog durch ein Feuer, dessen Gluth mich verzehren wollte, dann
durch donnernde Wogen, deren Kälte mich erstarrte, durch unendliche
Wolken- und Nebelschichten, hoch über der Erde, mit rasender,
entsetzlicher Schnelligkeit. Dann fühlte ich nur, daß ich überhaupt flog,
grad so, wie der Mond um die Erde wirbelt, ohne einen Gedanken, einen
Willen zu haben. Es war eine unbeschreibliche Leere um mich und in mir.
Nach und nach verminderte sich die Schnelligkeit. Ich fühlte nicht nur,
sondern ich dachte auch. Aber was dachte ich? Unendlich dummes, ganz und
gar unmögliches Zeug.«[11]
Eindringlicher konnte May seinen Seelenzustand gar nicht beschreiben. Noch
heute kann man aus seinen Worten, im Sommer 1885 niedergeschrieben, die
Ohnmacht und Verzweiflung spüren, die er empfand, als seine Mutter starb.
Später beginnt er ihren Tod zu verdrängen; sie kann, nein sie darf nicht
tot sein:
»[…] So oft ich vor diesem Grabe stehe, ist es mir, als ob mein Auge die
Kraft habe, durch die Erde und durch die Wände des Sarges zu dringen, und
da sehe ich ihn immer leer; […] Ist das Wahnsinn? Man behauptet ja, daß
ich wahnsinnig sei! Das quält mich ungemein! Das hat mich schon seit
Jahren gepeinigt und peinigt mich auch noch heut. Es packt mich oft so,
daß ich kaum widerstehen kann. Jetzt in diesem Augenblick, […] ist es so
stark und so deutlich, daß ich die Erde mit den Händen aufscharren möchte,
um […] zu zeigen, daß der Sarg leer ist! […] Ich möchte scharren und
scharren, […] aber diese That wäre so außerordentlich ungeheuerlich, daß
ich über den Wahnwitz erschrecke, sie mir denken zu können. Auch frage
ich, wo die Mutter denn sein sollte, wenn sie nicht hier wäre? Und ich
hatte und habe sie ja noch viel, viel zu lieb, als daß ich die Sünde auf
mich nehmen möchte, ihr Grab geöffnet und geschändet zu haben!«[12]
Diese Worte aus Karl Mays
allegorischem Spätwerk ›Ardistan und Dchinnistan‹ zeigen die ganze
Tragweite seines Denkens und Fühlens.


Es gab in Ernstthal fünf Begräbnisklassen. Die Trauerzeremonie für
Christiane Wilhelmine May erfolgte gemäß der III. Klasse. Es war nach den
damaligen Gepflogenheiten ein gutes Begräbnis: »Rede am Grabe oder in der
Begräbnishalle. Geläute Tags zuvor Vormittags zwischen 9–10 Uhr und
während des Leichenbegräbnisses, sowie Chorgesang unterwegs oder Abends
zuvor vor dem Trauerhause. (Gebühr: 20 Mark)«. Die erste Klasse hätte zum
Vergleich 30 Mark, die vierte Klasse 10 Mark gekostet.[13]
Nach der Beisetzung am 18. April 1885 schrieb Karl May zunächst am ›verlornen Sohn‹ weiter. Noch unter dem Einfluss der Trauer erreichte ihn die nächste Hiobsbotschaft – sein Vater Heinrich August May hatte einen Schlaganfall erlitten! Diese traurigen Ereignisse in Folge wirbelten Mays Manuskripte durcheinander. Er ist zunächst völlig am Schreiben verhindert, muss vorübergehend seine beiden Romane ›Der verlorne Sohn‹ und ›Die Liebe des Ulanen‹ vernachlässigen.[14] Während er sich bald wieder einigermaßen von seinem Schicksalsschlag erholt, bleibt sein Vater ein Pflegefall.
Einige Monate später teilt
Karl May als Kara Ben Nemsi in ›Der letzte Ritt‹ (im Band ›In den
Schluchten des Balkan‹ enthalten) mit:
›Die Mutter lebte noch, als ich nach Mekka pilgerte. Sie starb, und kurze
Zeit später traf den Vater der Schlag. Jetzt kann er kein Glied bewegen
und auch nicht sprechen, sondern nur lallen; dennoch betet er ohne
Unterlaß, daß Allah ihn erlösen möge, damit er mir nicht länger zur Last
falle. Ich aber bete heimlich zu der großen Muhabbet ilahi (Göttlichen
Liebe), ihn mir noch lange, lange zu erhalten.‹[15]
Heinrich August May starb am 6. September 1888 an »Altersschwäche« und
wurde am 9. September, an einem Sonntag, in ›Stille‹ beigesetzt.[16] Karl May, der seinen Vater
finanziell unterstützt hatte, war mit seiner Ehefrau Emma gewiss anwesend.
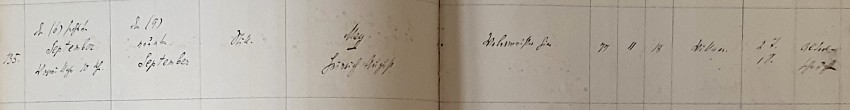
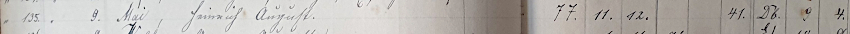
Von besonderem Interesse ist die Beantwortung der Frage über den Verbleib der sterblichen Überreste von Karl Mays Eltern. Was war damals in der Ernstthaler Pfarrgemeinde üblich?
»Es gab in dem kleinen Städtchen kein Sargmagazin, also keine fertigen Särge zu kaufen. Starb Jemand, so wurde der Sarg beim Tischler bestellt, und dieser hatte sich zu sputen, um ihn bis zur Stunde des Begräbnisses fertig zu bringen.«[17]
Die reguläre Grabnutzung/Liegezeit betrug für Erwachsene mindestens 25 Jahre. Die Grabhügel wurden 0,5 Meter hoch angelegt. »Die Gräber sind zur Ersparung des Raumes so nahe als möglich bei einander zu legen, jedoch darf der Zwischenraum zwischen denselben nicht weniger als 28,32 Zentimeter betragen. […] Bei erwachsenen Leichen müssen die Gräber eine Tiefe von wenigstens 1,7 Meter, bei Kindern von 2 bis 14 Jahren eine Tiefe von 1,42 Metern, bei Kindern bis zu 2 Jahren eine Tiefe von 1,14 Metern haben. Die Gräber müssen bei Erwachsenen 2,12 Meter lang, 1 Meter breit bei Kindern vom erfüllten 2. bis zum erfüllten 14. Jahre 1,56 Meter lang und 80 Zentimeter breit bei Kindern bis zum 2. Jahre 1,14 Meter lang und 57 Zentimeter breit sein.«[18]
27 Jahre nach der Einweihung der Friedhofserweiterung im Jahre 1881 begann man Ende April 1908 mit der Neubelegung des Quartiers ›D/a‹, die laut dem Gräber-Register in der 3. Reihe beim Grab 5 endete. Insbesondere bei Lehmböden, wie sie in Ernstthal zu finden sind, ist der Verwesungs- bzw. Zersetzungsprozess verlangsamt; er tritt in Einzelfällen gar nicht ein[19], was die Ursache sein kann, dass es in jener Zeit keine weiteren Neubestattungen auf den vorhandenen Gräbern in den Quartieren ›D/a‹ und ›D/b‹ mehr gab. Offensichtlich erfolgten fortan die Neubelegungen alter Grabstellen bis 1913 auf dem westlichen historischen Areal des Gottesackers, der heute bebaut ist; mit den ›D/a‹ und ›D/b‹-Quartieren geschah nichts. Bis mindestens 1910 durfte das Grab von Christiane Wilhelmine May (D/a, Reihe 12, Grab 12) ohnehin nicht geöffnet werden, desgleichen gilt für Heinrich August May (D/b, Reihe 9, Grab 4) bis 1913.
Da eine nochmalige Erweiterung des ›Gottesackers‹ an der Dresdner Straße nicht mehr möglich war, wurde im November 1913 ein völlig neuer Friedhof an der Lindenstraße, südöstlich vom Karl-May-Geburtshaus gelegen, in Betrieb genommen, der auch aktuell nach wie vor genutzt wird. Aus diesem Grund gab es auch später keine weiteren Graböffnungen mehr in den Quartieren ›D/a‹ (15 Grabreihen) und ›D/b‹ (26 Grabreihen bis 1896), wo Mays Eltern 1885 und 1888 bestattet wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass sie in der heutigen Kleingartenanlage noch unberührt ruhen. Im Übrigen wurde Mays Mutter laut Klara May, wie bereits erwähnt, tiefer bestattet als das festgelegte Mindestmaß von 1,70 Meter.
Ein detaillierter Plan mit den jeweiligen Grabreihen konnte nicht gefunden werden. Man weiß aber, dass die Reihen senkrecht (Nord/Süd-Richtung) zum erhaltenen Mittelweg verliefen. Die Särge waren damit – wie auch gegenwärtig nicht nur in Ernstthal allgemein üblich – von Westen (Kopfseite des Sargs) nach Osten ausgerichtet. Wo sich die einzelnen Flügel bzw. Quartiere des Friedhofs befanden, ist anhand der erhaltenen – allerdings nicht maßstabsgetreuen – Lageskizze bekannt, ebenso laut ›Gottesacker-Ordnung‹ die Grababstände. Die Zählung der Grabreihen begann vom ursprünglichen Friedhof kommend auf der Westseite der heutigen Kleingartenanlage, die Zählung der Gräber vom zentralen Mittelweg aus. Mit diesen Informationen lässt sich recht zuverlässig errechnen, wo die jeweiligen Grabstellen zu finden sind. Es ist aus rechtlichen Gründen problematisch, eine Luftbildaufnahme von Google Maps oder Earth mit den markierten Grabstellen zu veröffentlichen. Begnügen wir uns deshalb mit der Information, dass sich die Gräber von Mays Eltern zwischen dem Mittelweg und dem Bretterzaun an der Dresdner Straße befinden – ungefähr auf einer Höhe mit den gegenüberliegenden Häusern 91c/d und 91e.
Zum Schluss lassen wir Karl May selbst zu Wort kommen:
Auf
dem Friedhofe.
Komm her; komm her, du fremder Wandersmann;
Geh nicht vorbei an unbekanntem Grabe.
Hör mich, ja auch um deinetwillen, an,
Und glaube, was ich dir zu sagen habe!
Ein jeder Mensch, der nach dem Himmel strebt,
Soll hier ein liebes, gutes Wörtlein sagen;
Es wird der Seele, die da oben lebt,
Auf Händen des Gebets emporgetragen.
Dort nimmt sie es mit Freuden in Empfang
Und lächelt dankbar auf den Spender nieder,
Und dieses Lächeln strahlt ihm lebenslang
Das, was er gab, mit tausend Zinsen wieder.[20]
Diesen Forschungsbeitrag widme ich Frau Gabriele
Berger (1954–2021), die mit ihrem Artikel ›Karl
May und die Sankt-Trinitatis-Kirche zu Hohenstein-Ernstthal‹ für
die Archivarbeit der Kirchgemeinde neue Maßstäbe gesetzt hat.
Ich danke der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand für
die Archiveinsicht.
Namentlich danke ich herzlich Frau Ellen Jeschke sowie den Herren
Hans-Reinhard Berger, Thomas Jäkel-Lorenz und Wolfgang Hallmann – aus
Hohenstein-Ernstthal – für die hilfreiche Unterstützung.
Anmerkungen
[1]
Karl May: ›Der letzte Ritt‹. In: Deutscher Hausschatz in Wort und
Bild, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 12. Jg. 1885/86, Nr. 3, S.
40.
[2] Vgl. Bernd Günther: ›Zur Ernstthaler
Friedhofsgeschichte‹. In: Mitteilungen des Hohenstein-Ernstthaler
Geschichtsvereins, Heft 2/2005, S. 58.
[3] Ebd., S. 62f.
[4] Karl May: ›Die Todes-Karavane‹. In: Deutscher
Hausschatz in Wort und Bild, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 9.
Jg. 1882/83, Nr. 7, S. 107.
[5] Karl May: ›Der verlorne Sohn oder Der Fürst des
Elends‹, Dresden 1884–86, Lieferung 4, S. 73.
[6] Ebd., Lieferung 3, S. 70.
[7] Karl May: ›Die Liebe des Ulanen‹. In: Deutscher
Wanderer, 8. Band, Dresden 1883–85, Lieferung 86, S. 1362.
[8] Ebd., S. 1363.
[9] Aus einem 4 Seiten Manuskript Klara Mays von
1932 (Original im KM-Archiv Bamberg); zitiert nach Hans Wollschläger:
›Die sogenannte Spaltung des menschlichen Innern, ein Bild der
Menschheitsspaltung überhaupt‹. Materialien zu einer Charakteranalyse
Mays. In: Jb-KMG 1972/73, Hamburg 1973, S. 50 u. 89.
[10] Die
Ereignisse werden in der Karl-May-Bibliographie,
Zeitraum April bis Juni 1885, anschaulich dargestellt.
[11] Karl May: ›Der letzte Ritt‹, wie Anm. 1, Nr. 7,
S. 108.
[12] Karl May: ›Ardistan und Dschinnistan‹, Erster
Band, Manuskriptfassung, herausgegeben von Hans Wollschläger unter
Mitarbeit von Franziska Schmitt, Bamberg · Radebeul 2005, S. 302. –
Vgl. Ralf Harder: Karl May und seine Münchmeyer-Romane. Spiegel einer
geschundenen Seele. Eine Analyse zu Autorschaft und Datierung
(Internetfassung 2025), V. Werkgeschichte, 3.
Der Tod aller Mütter oder Ulane und Zouave.
[13] Vgl. Handgeschriebene ›Gottesacker-Ordnung‹
(1882), II Regulativ, Paragraph 5, Archiv der Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Ernstthal-Wüstenbrand.
[14] Ebd.,
S. 503.
[15] Karl May: ›Der letzte Ritt‹, wie Anm. 1, S. 40.
[16] Das bisher in der Sekundärliteratur genannte
Beerdigungsdatum ›10. September an einem Montag‹ ist nicht korrekt.
Vgl. Dieter Sudhoff/Hans-Dieter Steinmetz: ›Karl-May-Chronik‹, Bd. 1,
Bamberg/Radebeul 2005, S. 353. – Im Totenbuch und auch im
Gräber-Register ist der 9. September 1888, ein Sonntag, als
Beerdigungstag genannt. Damals waren Bestattungen an »Sonn- und
Festtagen« erlaubt. Vgl. das Königreich Sachsen betreffende ›Lexicon
des Kirchenrechts und der Pfarramtsführung‹, bearbeitet von Wilhelm
Haan, Leipzig 1860, S. 49. – Wenige Tage nach der Beisetzung von
Heinrich August May wurde am 16. September 1888 Max Otto Selbmann,
Sohn »der ledigen Näherin Minna Selbmann« (Grabregister: Quartier E/b, Reihe 18, Grab 13), bestattet.
Es handelt sich folglich nicht um ein Kind von Mays Schwester Karoline
Wilhelmine Selbmann.
[17] Karl May: ›Der verlorne Sohn oder Der Fürst des
Elends‹, wie Anm. 5, Lieferung 26, S. 611.
[18] Handgeschriebene ›Gottesacker-Ordnung‹ (1882),
B. Von den einzelnen Grabstellen, Paragraph 18, Archiv der Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand.
[19] Auf dem seit 1913 genutzten Ernstthaler Friedhof
dürfen inzwischen die Verstorbenen nicht mehr in einem Eichensarg
beigesetzt werden, da der Lehmboden die Verwesung erschwert. Aus der
aktuellen Friedhofsordnung: »Wenn beim Ausheben eines Grabes zur
Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnenreste gefunden werden,
sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versenken.
Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab
sofort wieder zu schließen und als Bestattungsstätte für Leichname für
die erforderliche Zeit zu sperren.«
[20] Karl May:
›Himmelsgedanken‹, Freiburg [1900], S. 96.